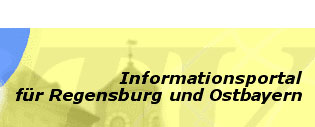| |
| |
|
Announcement
Schaubühne
Hedda Gabler
von Henrik Ibsen
Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel
Regie: Thomas Ostermeier
Bühne
Kostüme
Musik
Dramaturgie
Video
Licht
Die
Generalstochter Hedda Gabler hat geheiratet.
Ihrem Ehemann, dem aufstrebenden Historiker
Jörgen Tesman, winkt eine Professur; er hat sich
daraufhin Geld geliehen und eine Villa gekauft,
um seiner anspruchsvollen Frau etwas bieten zu
können.
Seinen Nebenbuhler, den attraktiveren und
begabteren Lövborg, hat Hedda abblitzen lassen.
Lövborg, der gerne in berüchtigten Clubs seinen
glänzenden Intellekt mit Drogen betäubte, war
finanziell und gesellschaftlich keine
aussichtsreiche Perspektive für sie gewesen.
Jetzt kehrt Hedda ernüchtert aus den
Flitterwochen zurück und muss erfahren, dass
Lövborg mittlerweile sein Lotterleben an den
Nagel gehängt hat. Er hat ihre Abwesenheit
genutzt, um ein aufsehen erregendes
kulturgeschichtliches Buch zu schreiben, und
dessen überwältigendes Echo lässt Tesmans
Berufung zum Professor plötzlich mehr als
fraglich erscheinen.
Hedda zerrinnt ihr Lebensplan zwischen den
Fingern. Gegen ihre Neigung hatte sie sich für
ein Leben nach bürgerlichen Prinzipien
entschieden. Als diese Prinzipien nun nicht
halten, was sie versprachen, nämlich ökonomische
Sorglosigkeit, beginnt sie, sich und ihre Umwelt
zu hassen und läuft Amok:
Sie verhöhnt hemmungslos ihren Ehemann,
hintergeht ihn mit dem Hausfreund Brack,
hintertreibt aus Eifersucht die Verbindung
zwischen Lövborg und dem Fräulein Elvsted; sie
verbrennt Lövborgs zukunftsweisendes Werk,
treibt ihn zuerst zurück in die Sucht
und schließlich in einen Selbstmord »in
Schönheit«.
Mit erbarmungslos wütender Hellsicht attackiert
sie die erdrückende Gutartigkeit, hinter der
ihre Mitmenschen Mittelmaß und Feigheit vor dem
Leben verbergen.
Manipulation und Lüge sind die Mittel, mit denen
sie virtuos innerhalb nur eines Tages und einer
Nacht diese von Aufstiegsdenken und
Abstiegsangst dominierte Welt zum
Einsturz bringt.
Zuletzt wird sie selbst als Teil des Systems zur
Zielscheibe ihrer Zerstörungswut: Sie kann ihr
selbstgebautes Gefängnis nicht sprengen, ohne
sich selbst zu zerstören.
In seinem 1891 am Hoftheater in München
uraufgeführten Stück zeigt Ibsen einen Angriff
auf das Bürgertum von innen. Als
zusammengehörige Klasse mit gemeinsamen Werten
ist das Bürgertum heute schwer auszumachen, aber
die bürgerlichen
Sehnsüchte und Ängste, die seit dem 19.
Jahrhundert Biographien kontrolliert, reguliert
und deformiert haben, sind heute in alle
finanziellen Schichten der Gesellschaft
diffundiert. Die Angst vor dem sozialen Abstieg
ist unser kollektives Leitmotiv geworden.
Wir sind wieder reif für die Herausforderung und
Zumutung einer Hedda Gabler.
|
| Besetzung
|
|
|
|
|
Jørgen Tesman, Privatdozent der
Kulturgeschichte |
Lars
Eidinger |
|
|
| Frau
Hedda Tesman, seine Frau |
Katharina Schüttler |
|
|
|
Fräulein Juliane Tesman, seine Tante |
Lore
Stefanek |
|
|
| Frau
Elvstedt |
Annedore Bauer |
|
|
|
Richter Brack |
Jörg
Hartmann |
|
|
|
Eilert Løvborg |
Kay
Bartholomäus Schulze |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Ibsen und
Strindberg,
Dramatiker
des
ausgehenden
19.
Jahrhunderts,
sehen die
Lebenslüge,
Heuchelei in
der
Gesellschaft,
Selbstgerechtigkeit
der
Gesellschaft
im
Mittelpunkt
ihres
Wirkens.
Mit der
Übersiedlung
Ibsens nach
München im
Jahr 1875
begann die
Serie der
'Gesellschaftsdramen',
die mit
schonungsloser
Offenheit,
in
kritischer
Betrachtungsweise,
gekonnter
Technik, die
Probleme des
sozialen
Milieus
durch
Schaffung
der
entsprechenden
Atmosphäre
auf die
Bühne zu
bringen, die
heftige
Diskussionen
auslöste und
die Kritiker
auf den Plan
rief.
Ibsens Werke
finden ihren
Weg aus der
sozialkritischen
Phase in
eine
symbolische,
mystische
Welt. Die
Reihe endet
mit dem
dramatischen
Epilog 'Wenn
wir Toten
erwachen'.
Der
norwegische
Dichter hat
mit seinem
Werk die
nachfolgenden
Perioden der
Arbeit im
Theater
durch
Hauptmann,
Shaw,
Strindberg,
Wedekind,
Kaiser bis
hin zu
Sartre und
Anouilh
stark
beeinflusst.
"Alles, was
ich
gedichtet
habe, hängt
aufs engste
zusammen mit
dem, was ich
durchlebt
habe, wenn
auch nicht
erlebt
habe."
schreibt
Ibsen 1880
an den
ersten
deutschen
Übersetzer
seines Peer
Gynt, Ludwig
Passarge.
Die
Beschreibung
der
Emanzipationsbemühungen
der Frau
nahm in
Ibsens
Werken
ihren
Anfang, als
seine 'Nora'
auf die
Bühne kam.
Nora erfährt
das Wunder
nicht,
Torvald
Helmer, ihr
Mann steht
nicht zu
ihr, er
kritisiert
ihr
Fehlverhalten
der
Urkundenfälschung,
sie verlässt
ihn und
Kinder -
emanzipiert
sich.
Das Ende der
'Nora' endet
aus heutiger
Sicht
unspektakulär
- Frau Nora
Helmer
verlässt die
Familie.
Bei 'Hedda
Gabler'
führt der
verzweifelte
innere Kampf
der
Titelfigur
zum
initiierten
Selbstmord
einer der
Figuren und
zum
Selbstmord
der
Titelfigur
selber.
Kaum noch
nachvollziehbar,
aus welchen
Gründen
Hedda
handelt.
Sie, die von
Tesman in
jeder
Hinsicht -
wohl auch
geistig
aufgrund
ihrer
mangelnden
Schulbildung
- nicht zu
befriedigende
Frau, die
jede
Gelegenheit
nutzt, sich
anderen
Männern
zuzuwenden,
die mit
allem
unzufrieden
ist, das
Leben nicht
wie Thea
Elvstedt -
wie Nora -
in die Hand
nimmt und
aus der Ehe
ausbricht,
sondern ihre
Umwelt
traktiert.
Sie lehnt es
ab, die
Tante
Tesmans zu
duzen, die
Kopfbedeckung
der Tante
auf dem
Sessel, die
kleinbürgerliche,
auf
Sparsamkeit
ausgerichtete
Welt Tesmans
stört sie,
Thea
Elvstedt
erinnert sie
daran, dass
sie die
Schulkollegin
schon in der
Schule
ärgerte, an
den Haaren
zog - jetzt
da die
Schulkollegin
wieder in
ihr Leben
tritt, wird
weiter
schikaniert.
Es wird
deutlich,
dass Hedda
nur das
eingeschränkte
Leben des
Vaters als
Soldat, als
General
kannte, sich
nicht
entwickelte
und nun
feststellt,
dass sie
geistig
weder mit
Tesman, dem
Privatdozenten
der
Kulturgeschichte,
noch mit
Thea
mithalten
kann, die
schon früher
bei
schriftstellerischen
Arbeiten
mitwirkte.
Als
Kompensation
für diesen
selbsterkannten
Mangel wird
von ihr der
eine gegen
den anderen
ausgespielt,
zu dessen
eigenem
Nachteil
beeinflusst,
nur um zu
zeigen, wie
sehr sie
aktiv ist
und ihre
Umgebung
beherrscht
und diese
dabei ins
Unglück
stürzt. Hat
sie selber
aber hat sie
Angst vor
jedem
Skandal, vor
dem
'Was-werden-die-Leute-sagen'?
Eilert
Løvborg, der
durch Thea
zu einem
drogenfreien
Leben und zu
seiner
literarischen
Arbeit
zurückgefunden
hat, wird
von Hedda so
lange zu
einer Tat in
voller
Schönheit
gedrängt,
sie
überlässt
ihm eine der
beiden
Pistolen des
Vaters,
damit er mit
'Weinlaub im
Haar' das
tun kann,
was nur mit
äußerstem
Willen zu
vollbringen
ist, sich zu
töten.
Als sie
erfährt,
dass der
Selbstmord
nicht durch
Treffen des
Herzens in
der Natur
geschieht,
sondern in
einem
Bordell
durch einen
unabsichtlichen
Schuss in
den Bauch,
bricht für
sie auch
dieses
letzte für
sie so
wichtige
'Den-schönen-Schein-erwecken'
zusammen.
Die Tatsache
der von
Hedda an
Løvborg
ausgegebenen
Schusswaffe
wird dem
Richter
Brack
bekannt und
dieser
findet darin
Gelegenheit
zur
Erpressung
von
Liebesdiensten
durch sie.
Aus dieser
Falle findet
sie nicht
mehr heraus,
weg von den
Menschen,
die
Einsamkeit
im Tod ist
für sie die
einzige
Lösung.
|
|
|

|
In der Zeit
von Juni bis
18. November
1890
schreibt
Henrik Ibsen
das
Schauspiel
in vier
Akten 'Hedda
Gabler', um
deren
Uraufführung
sich Herzog
Georg II.
von
Sachsen-Meiningen
bemüht.
Dieser muss
das Vorhaben
aufgeben, da
ihm die
richtige
Darstellerin
der
Titelrolle
fehlt.
Für den
31.1.1891
setzt das
Residenztheater
in München
die erste
Vorstellung
- im Beisein
des Autors -
seiner
Produktion
der 'Hedda
Gabler' auf
den
Spielplan,
elf Jahre
nach dem
auch seine
'Nora' hier
dem Publikum
vorstellt
wurde.
Hatte 1880
der Schluss
der 'Nora'
irritiert,
weswegen
dieser
zunächst
'durch
Fremdeinwirkung',
später von
Ibsen selber
dahingehend
geändert
wurde, dass
Nora nicht
aus dem Haus
geht und
Mann und
Kinder eben
nicht allein
zurücklässt
- so wird
auch die
'Hedda' vom
Publikum
wegen ihrer
'Unfassbarkeit'
abgelehnt,
wohl weil
die
Darstellerin
der
Titelrolle
es nicht
vermochte,
die
Problematik
der Figur zu
vermitteln.
|
Königlich
privilegirte
Berlinische
Zeitung
von
Staats-
und
gelehrten
Sachen
-
Vossische
Zeitung,
No.
54
Abend-Ausgabe,
Montag
den
2.
Februar
1891.
München,
1.
Februar.
(Eig.
Mitth.)
Unter
heftigen
Beifalls-
und
Mißfallensbezeigungen
ist
"Hedda
Gabler",
Ibsen´s
neustes
Werk,
gestern
zum
ersten
Mal
aufgeführt
worden;
einen
wirklichen,
inneren,
dauernden
Erfolg
hat
es
nicht
zu
erringen
vermocht.
Es
findet
dies
seine
Begründung
vielleicht
in
dem
seltsam
räthselhaften
Charakter
der
Heldin,
die
sich
mit
den
lächerlichsten
Kleinigkeiten
ernsthaft
beschäftigt
und
mit
dem
Fürchterlichsten
lächelnd
spielt;
sie
ist
schwer
verständlich,
diese
Frau
mit
der
verdorbenen
Phantasie,
dem
Durst
nach
Lebensgenuß
und
der
Feigheit
vor
jedem
Schritt,
der
über
die
Alltäglichkeit
hinausführt
-
hier
muß
die
Darstellung
dem
Dichter
zu
Hilfe
kommen,
und
das
ist
gestern
nicht
geschehen.
Frl.
Heese
hat
sich
bei
der
Auffassung
der
Hedda
total
vergriffen
und
damit
dem
Stücke
allen
Grund
und
Boden
entzogen.
Schon
bei
ihrem
ersten
Auftreten
ließ
ihre
verstörte
Miene
und
ihr
tragischer
Ton
keinen
Zweifel
hierüber
bestehen;
als
sie
nun
gar
später
in
ein
ganz
hohles
Pathos
verfiel
und
am
Schlusse
des
ersten
Aktes
mit
verzweifeltem
Ausdruck
und
dröhnender
Stimme
erklärte,
daß
sie
sich
jetzt
mit
Pistolenschießen
amüsiren
werde,
war´s
einfach
um
die
Rolle
geschehen.
Die
ohnehin
seltsamen
und
immer
wiederkehrenden
Worte
"mit
Weinlaub
im
Haar"
erregten
ungezügelte
Heiterkeitsausbrüche,
und
als
die
Darstellerin
sich
im
vierten
Akte
wirklich
zu
großer
Kraft
aufschwang
und
wenigstens
das
Dämonische,
welches
in
dem
Charakter
der
Hedda
liegt,
zur
Geltung
brachte,
war
das
Publikum
längst
um
seine
Stimmung
gebracht
und
faßte
komisch
auf,
was
nur
irgend
komisch
aufgefaßt
werden
konnte.
Das
Bedauerlichste
war
jedoch
hierbei,
daß
man
diese
Hedda
nicht
der
Schauspielerin,
sondern
dem
Dichter
als
Mißgriff
anrechnete;
nur
derjenige,
der
das
Stück
gelesen
hatte,
konnte
ahnen,
wie
himmelweit
verschieden
Dichtung
und
Darstellung
wirkten.
Die
Rolle
der
Thea
Elvstad
in
den
Händen
von
Marie
Conrad-Ramlo
trat
dem
gegenüber
in
ihrer
erstaunlichen
Naturwahrheit
doppelt
scharf
hervor
und
wurde
dadurch
eigentlich
die
interessanteste
Person
des
ganzen
Stückes;
für
die
geniale
Künstlerin
bedeutet
das
einen
großen
Triumph,
für
das
Ibsen´sche
Werk
aber
eine
vollständige
Verschiebung
der
Anlage.
Stury
(Tesman),
Bonn
(Lövborg),
Keppler
(Brack)
waren
theilweise
gut.
Frau
Dahn-Hausmann
sogar
vortrefflich,
nur
litt
die
ganze
Aufführung
unter
einem
viel
zu
langsamen
Tempo.
Ibsen
wurde
nach
den
beiden
letzten
Akten
je
drei-
und
viermal
stürmisch
gerufen,
obwohl
die
Gegner
des
Dichters
sich
alle
Mühe
gaben,
den
Enthusiasmus,
der
unter
den
obwaltenden
Verhältnissen
allerdings
nicht
ganz
gerechtfertigt
war,
durch
energisches
Zischen
zu
dämpfen.
|
Hedda
Gabler, eine
Frau im
ausgehenden
19.
Jahrhundert,
etwa am
Beginn ihrer
dreissiger
Lebensjahre,
die als
einziges Kind
aus einem
Haushalt mit
militaristischem
Hintergrund
stammt. Der
Vater
General
übernahm
typischerweise
aufgrund
seiner
Stellung
alle
Entscheidungen,
der Drill
der Tochter
reichte
gerade zur
eigentlichen
Aufgabe in
der
damaligen
Zeit: zu
gefallen, um
einen
Ehemann zu
finden, der
die
Versorgung
der meist
ungebildeten
Töchter -
für die
unteren
Schichten
war eine
Schulbildung
schon aus
Kostengründen
kaum möglich
- für die
Zeit ihres
Lebens
übernimmt.
Beide Werke
'Nora' wie
auch 'Hedda'
zeigen die
Problematik
der
unselbständigen
Frau im 19.
Jahrhundert
- ohne
entsprechende
eigene
Einkünfte,
weil ohne
Bildung, die
allenfalls
zur Führung
eines
Haushaltes
hinreichte.
Nora Helmer
hatte in der
Originalfassung
das damals
Unsägliche
für sich in
Anspruch
genommen,
die Ehe zu
verlassen,
als ihr Mann
sich wegen
ihres
Rechtsbruchs
von ihr
abwendet,
obwohl sie
ihn nur
durch einen
Kuraufenthalt
mit ihr und
dem gerade
geborenen
Sohn Ivar in
Italien, für
das sie das
Geld durch
eine
Bürgschaft
des Vaters,
dessen
Unterschrift
auf der
Urkunde sie
fälscht,
erhalten
konnte, das
Leben
rettet.
Hedda Gabler
geht eine
Ehe mit dem
promovierten
Kultur-Wissenschaftler,
den
ungeschätzten
Jørgen
Tesman -
dieser
elternlos im
Hause von
Tanten
aufgewachsen
- ein, die
eben eine
solche
wirtschaftliche
Absicherung
nach dem Tod
Vaters, des
pensionierten
Generals,
sicherstellen
soll.
Ihre
fehlende
Bildung
macht ihr
das Leben
neben
dem Akademiker
Tesman
schwer, sie
hat keine
Möglichkeit,
ihm geistig
zu folgen,
sich mit
seinen
Interessen
auseinanderzusetzen
und ihn zu
unterstützen.
Aufgrund
ihrer
Herkunft aus
einem
Generalshaushalt
ist sie
mangels
Kenntnissen
auch nicht
in der Lage
und darum
auch nicht
Willens, das
Haus zu
führen.
Aufgrund der
prekären
wirtschaftlichen
Lage Tesmans
- das ihnen
zur
Verfügung
stehende
Haus ist
überschuldet,
die
Absicherung
der
Einrichtung
meint eine
Tante von
Tesman durch
Verpfändung
ihrer und
ihrer
Schwester
Rente -
'eine reine
Formsache' -
sichergestellt
zu haben -
auf den
Diener in
Livrée und
das von
Tesman
versprochene
Reitpferd
verzichten.
Die durch
die Ehe mit
Tesman
erwartete
Versorgung
auf hohem
Niveau kann
also von ihr
nicht
erzielt
werden, da
sich die
Karriere
Tesman's als
Professor
durch das
Auftauchen
eines
Konkurrenten
als nahezu
unrealistisch
zeigt.
Hedda hat
nichts
gelernt, mit
dem sie den
Tag sinnvoll
gestalten
kann. Es
fehlen ihr
mangels
intellektueller
Gaben
sämtliche
Voraussetzungen
hierfür.
Glücklicherweise,
wie sie es
sieht, hat
sie doch
etwas zum
Zeitvertreib
- die
Pistolen aus
der
Erbschaft,
mit denen
sie so ins
Blaue
schießen
kann.
Eine
väterlicherseits
stark
männlich
geprägte
Erziehung -
von der
Mutter ist
im Stück
nicht die
Rede - hat
in diesem
Vater /
Tochter-Verhältnis
eine harte
Frau aus
Hedda
gemacht, der
es darum
geht - dem
Vorbild
General-Vater
nachzueifern,
dies möglich
durch eine
entsprechende
- im 19.
Jahrhundert
viel
diskutierten
Naturalismus
- erbliche
Belastung,
also von der
Veranlagung
her alles
mitbringend,
das ihr
Vorgelebte
adaptierend
- Einfluss
auf das
Leben
anderer zu
nehmen, zu
befehlen und
damit zu
beherrschen.
Ihre
früheren
männlichen
Partner
entzogen
sich Heddas
Gängelung,
auch Eilert
Løvborg, 'einer
ihrer
heißester
Beschützer -
in seiner
Blütezeit',
der von ihr
mit der
Pistole
bedroht
wurde als er
sie verließ,
der dann dem
Alkohol
verfiel,
aber in der
Abgeschiedenheit
im Norden
des Landes
als
Hauslehrer,
der von ihm
zu
unterrichtenden
Kinder aus
der ersten
Ehe des
Hauherrn, zu
sich und
unter
Mithilfe der
Hausfrau,
Thea
Elvstedt, zu
seiner
Profession
als
wissenschaftlicher
Autor
zurückfindet.
In ihm
erwächst ein
Konkurrent,
der Tesman
bei der
Erlangung
der
ausgeschriebenen
Stelle als
Professor
gefährlich
werden
könnte. Als
Løvborg, von
Hedda zum
Alkoholkonsum
gedrängt,
bei dem
zeitlich
unmittelbar
folgenden
Herrenabend
abstürzt und
dem alten
Laster
wieder
verfällt, er
später dann
seine
Situation
realisiert,
empfiehlt
sie ihm, die
seinerzeit
von ihr auf
ihn
gerichtete
Pistole nun
selber zu
nutzen und
'in
Schönheit'
'so früh das
Fest des
Lebens zu
verlassen.'
Mit
Selbstmord
oder Duell
löste man
persönliche
Probleme in
dieser Zeit.
Ibsen zeigt
am Beispiel
der Thea,
die
tatsächlich
Ehemann und
dessen
Kinder
verlässt,
dass sich
eine Frau im
19.
Jahrhundert
sehr wohl in
die
berufliche
Arbeit eines
Mannes
einbringen
und sich
dabei selbst
verwirklichen
kann, um
dann im
Falle Tesman
neben ihm
dieses eine
geisterfüllte
Leben - nach
Eilert
Løvborg - in
Museen oder
Bibliotheken
z.B. durch
Aufarbeiten
von Papieren
weiterführen
zu können,
Dass Frauen
im 19.
Jahrhundert
sich auch
anders
verhalten
konnten,
zeigen
Beispiele:
Franz Liszt
fand in
Carolyne von
Sayn-Wittgenstein
eine
Partnerin,
die an
seinen
Ideen,
Vorhaben und
Kompositionen
starken
Anteil nahm.
Ob Liszts
Weimarer
Jahre ohne
sie so
fruchtbar
gewesen
wären, darf
bezweifelt
werden.
In der
Münchener
Zeit Richard
Wagners - ab
1864 - war
Cosima noch
mit Hans von
Bülow
verheiratet.
Neben ihren
eigenen
häuslichen
Verpflichtungen
in der
Luitpoldstraße
ging sie
jeden Tag in
die Brienner
Straße und
koordinierte
dort Wagners
Tagesablauf,
erledigte
seine
Korrespondenz
und
überwachte
die Abläufe
auch dieses
Haushalts.
Minna
Planer, die
erste
Ehefrau
Richard
Wagners, war
in all den
Jahren in
Riga, Paris,
Dresden und
nach der
Flucht auch
in Zürich
die züchtige
Hausfrau,
die ihm ein
Haus
einrichtete
- ihre
geistigen
Möglichkeiten
reichten
aber über
den 'Rienzi'
kaum hinaus.
Daher musste
mit dem
Erscheinen
der Muse
Mathilde
Wesendonck
das
Verhältnis
zu Minna
zwangsläufig
ein Ende
finden.
Sie merkte,
dass sie
Mathilde und
später
Cosima
geistig
unterlegen
war, mit
Richard
Wagners
Entwicklung
nicht
mithalten
konnte und
die
Haushaltsführung
war mit der
Auflösung
des 'Asyls'
1859
beendet, so
dass sie
keine
Aufgabe für
sich im
Zusammenleben
mit Richard
Wagner mehr
fand.
Hedda kann
weder - als
geringste
Herausforderung
- den
Haushalt für
Tesman
führen -
(ist sie in
der Lage,
einen Faden
in eine
Nadel
einfädeln zu
können?) -
Tante Julle
Tesman ist
froh,
einspringen
zu können
und
gebraucht zu
werden -
noch kann
Hedda ihren
angeheirateten
Tesman in
seiner
wissenschaftlichen
Arbeit
unterstützen
wieThea es
bei Løvborg
praktizierte
und am Ende
des Werkes
Thea dies
bei Tesman
wiederholen
wird.
Dass Frauen
erst seit
dem Anfang
des 20.
Jahrhunderts
ein Studium
aufnehmen
durften und
durch
Veröffentlichungen
von Dr. Otto
Weiniger
unter dem
Titel
'Geschlecht
und
Charakter'
in ihrem
Fortkommen
beeinträchtigt
wurden, darf
beim
Inszenieren
von Ibsens
Werken nicht
außer Acht
gelassen
werden.
|
Dr.
Otto
Weininger
'Geschlecht
und
Charakter'
Wien
/
Leipzig
1903
Das
absolute
Weib
hat
kein
Ich
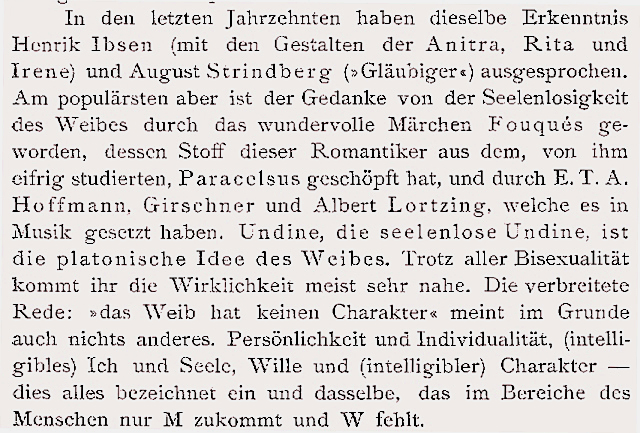
Seite
241
|
|

|
Die Berliner
Ostermeier-Inszenierung
wird in
ihrer
Wirkung
maßgeblich
beeinflusst
durch das
Bühnenbild
von Jan
Pappelbaum -
ein Bungalow
der 60-er
Jahre, der
Entwurf des
Gebäudes
könnte von
Richard
Neutra oder
eher noch
Sepp Ruf
stammen, der
auf die
Drehbühne
gesetzt die
Möglichkeit
schafft,
wechselnd
Frontansicht,
oder
seitliche
wie auch
Rück-Ansichten
zu zeigen.
Blick aus
dem Garten
in das
Gebäude wie
auch aus dem
Salon in den
Garten durch
verschiebbare
deckenhohe
Glaswände,
an denen
zeitweise
Regenwasser
herunterläuft
und an die
Eilert
Løvborg 'von
außen'
haucht, die
unterkühlte,
melancholische
Herbststimmung
verdeutlichend.
Die
Hauptspielfläche
nur mit
einer
überdimensionalen
Couch über
Eck in
heutigem
Design
ausgestattet.
Die
verschiebbaren
Glasflächen
erlauben
Auftritte
und Abgänge
von der
Vorder- auf
die
Hinterbühne
vv., so dass
Bewegung der
Figuren im
Haus, nach
draußen und
drinnen sich
ergeben oder
Darsteller
an der
geschlossenen
Glaswand
'außen'
stehend,
'drinnen' in
den Ablauf
der Handlung
einbezogen
werden.
Über diesem
'Gebäude'
eine
Spiegelfläche,
so dass
jeweils
Einblicke in
die dem
Publikum
abgewandten
Spielräume
möglich
sind. Man
sieht so,
wie Thea und
Tesman
'hinter der
Szene' mit
dem
Aufarbeiten
der
Unterlagen
zu Løvborg's
Buch
beginnen,
Notizzettel
werden an
die Wände
geklebt und
der
Vorderbühne
am Boden
ausgelegt.
Ein Werk,
vom Autor
ins
ausgehende
19.
Jahrhundert
angelegt,
spielend ins
Heute zu
übertragen,
birgt
Probleme,
denn eine
solche
’Hedda
Gabler’, die
trotz
Striche –
die Rolle
der Berte
fehlt ganz -
Umformulierungen
und
Änderungen
z.B. der
Vernichtung
des
Løvborg’schen
Manuskripts
im Kamin,
hier durch
Zertrümmern
des Laptops
und
Verheizen im
Grill, ein
derartiges
Verhalten an
den Tag
legt,
entspricht
nicht den
Intentionen
des Autors
eines
Anprangern
des Status'
der Frau am
Ende des 19.
Jahrhunderts
in
Mitteleuropa.
|

Fhttp://www.welt.de/wissenschaft/article351929/Ueber_den_weiblichen_Schwachsinn.html
Der Neurologe Paul Julius Möbius wurde vor 150 Jahren geboren.
Seine Thesen über die geistigen Fähigkeiten und Seelenzustände der Frau machten ihn berühmt und berüchtigt.
"[...]
Möbius
warnt:
Übermäßiges
Denken
macht
Frauen
krank
Möbius
ging
davon
aus,
dass
die
Natur
den
zwei
Geschlechtern
unterschiedliche
Aufgaben
zugedacht
hatte.
Der
Mann
mit
dem
äußerlich
besser
entwickelten
Scheitellappen
hatte
das
Potenzial
zum
Gelehrten
oder
Künstler.
Die
Frau
hingegen
gehörte
an
den
Herd,
ins
Wochenbett
und
hatte
die
Kinder
zu
erziehen.
„Gelehrte
und
künstlerische
Frauen
sind
Ergebnisse
der
Entartung“,
erläuterte
der
Leipziger.
Er
warnte,
dass
übermäßige
Gehirntätigkeit
das
„Weib
nicht
nur
verkehrt,
sondern
auch
krank“
mache.
Die
Liste
der
einprägsamen
Sätze
aus
Möbius‘
Hirn
lässt
sich
fortsetzen.
Sein
Material,
besonders
aber
das
genannte
Hauptwerk,
hat
der
Frauenforschung,
Feministinnen,
aber
auch
Medizinern
in
ihrer
historischen
Reflexion
als
Quelle
gedient.
„Sein
Buch
ist
ein
Dokument
der
Sozial-
und
Mentalitätengeschichte
und
auch
ein
Schwanengesang
nach
4000
Jahren
patriarchalischer
Gesellschaftsstruktur
und
Rollenzuweisung“,
urteilt
der
Medizinhistoriker
Marcel
H.
Bickel
(Bern)
in
der
Schweizerischen
Ärztezeitung.
Allerdings
traf
Möbius
einen
empfindlichen
Nerv
der
Männerwelt.
Sein
Buch
verkaufte
sich
ganz
gut
bis
zum
Vorabend
des
Ersten
Weltkriegs,
erreichte
mehr
als
ein
Dutzend
Auflagen.
[...]"
|
Somit wird
die
Schaubühne
mit dem
Zeigen der
Hedda in
einem
heutigen
Umfeld der
Figur Ibsens
nicht
gerecht. Die
Darstellerin
steht neben
der Rolle,
alles was
sie tut,
passt nicht
in das der
Ehefrau
eines
promovierten
Kultur-Wissenschaftlers
um 1890 bzw.
nicht ins
heutige Bild
einer Frau.
Es sei denn,
das alles
ist
exemplarisch
für einen
TV-Krimi
oder in
einer daily
Soap in der
754 Folge zu
erleben,
nach den
Motto
'Schlechte
Zeiten im
Lindenhof'.
Da könnte
auch, wie in
Ulm vom
heutigen
Meininger
Intendanten
Ansgar Haag
inszeniert,
eine
Inzeststory
Vater /
Tochter
übergestülpt
werden oder
Hedda ein
Verhältnis
mit Thea
haben.
Das Problem
des
krampfhaften
Verheutigens
betrifft
auch die
'Drei
Schwestern'
an der
Schaubühne.
Ein Werk
ebenfalls am
Ende des 19.
Jahrhunderts
angesiedelt,
kann nicht
neben
Kühlschrank
(als Symbol
des
Überflusses)
und
Alu-Möbeln
in Szene
gesetzt
sein, kann
nicht die
Atmosphäre
mit Duell im
Off zur Zeit
der Zaren im
damaligen
Russland
zeigen.
|

|
Für
Hedda ist
alles nicht
so gekommen
wie sie es
wollte,
alles ist
ihr lästig,
alles ödet
sie an.
Aber wusste
sie
überhaupt,
auf was sie
sich
einlässt?
Die ganze
Umgebung,
das Haus,
die Blumen
zum Empfang,
Tante Julle
mit ihrer
neuen Mütze,
Tesmans
Pantoffeln
aus der
alten
Wohnung
mitgebracht,
Tesman mit
seinen
Papieren und
Studien,
Løvborg's
Arbeit an
dessen Buch
- alles das
interessiert
sie nicht
einmal am
Rande, sie
sucht nur,
da sie
selber für
sich und
andere im
Positiven
nichts
zustande
bringt, ihm
und Thea und
deren
gemeinsamen
Studien zu
schaden, sie
verleitet
Løvborg zum
Trinken,
obwohl sie
weiß, dass
er damit
wieder dem
Alkohol
verfallen
muss.
Die
Darstellerin
der Hedda
spielt so
gekonnt, in
der Sprache
alles
reduzierend,
dass dem
Publikum
klar wird,
wozu eine
Frau
überhaupt
und gerade
mit dieser
Art, sich zu
geben, fähig
ist.
Sie nutzt
ohne Scheu
jede sich
ihr
ergebende
Möglichkeit,
lamentierend,
direkt oder
subversiv
Einfluss zu
nehmen.
Rabiat wird
sie als sie
Tesman den
Aktenkoffer
entringt, um
an das
Manuskript
zu gelangen.
Eine das
Verhalten
Heddas stark
bestimmende
Figur ist
der
leichtlebige
Jurist
Brack, ein
Freund des
Hauses und
langjähriger
Verehrer von
Hedda, der
ein großes
Interesse
hat,
'alleiniger
Hahn im
Korb' in
einem
Dreiecksverhältnis
zu sein -
Tesman und
Hedda, Hedda
und Brack
und
möglicherweise
auch Brack
und Tesman.
Als Brack
ihr deutlich
macht, dass
er sie in
der Hand hat
und selbst
beim eigenen
Tod - sie
wehrt sich
nicht,
trumpft
nicht auf,
wird nicht
laut, alles
läuft ohne
Spektakel
mit
reduzierter
Lautstärke
ab.
Hat diese
Kühle
Blonde, bei
diesem
Verhalten,
in dieser
verheutigenden
Inszenierung,
wirklich
Angst vor
einem
Skandal, mit
dem Prinzip
der
Unschuldsvermutung
bei einem
Polizeiverhör
oder
Gerichtsverhandlung?
Es schreckt
sie doch
wohl eher
die
Eintönigkeit
dieses
Lebens oder
die
Erkenntnis,
in andere
Sphären
nicht
eindringen
zu können?
Die
Protagonistin
der
Titelrolle
praktiziert
den gesamten
Abend einen
Tonfall, der
ihren
Überdruss,
als 'Grüne
Witwe' und
deren
geistige
Minderbemittlung
zweifelsfrei
dokumentiert.
Ibsens Text
enthält aber
Möglichkeiten
die Menge,
Monotonie
nicht
zuzulassen
bzw. aus
dieser
auszubrechen
und bei der
Vermittlung
des Inhalts
über die
Modulation
der Sprache
beim
Publikum
wechselweise
Spannung und
Ausgleich zu
erzeugen.
Es wird
interessant,
Kleist's
'Penthesilea'
an der
Schaubühne
'zu hören',
wie hier die
Sprache von
der
Darstellerin
angelegt
wird.
|
|
|

|
|
|
Anders
selbst die
kleine Rolle
der Tante
Juliane
Tesman, die
engagiert
über das
gesprochene
Wort und die
Tongebung
die
mitfühlende
Tante zeigt
oder Thea,
die durch
Gestaltung
des Textes
sehr
deutlich
macht, wie
sie am
Leben,
Werden und
Vergehen des
Eilert
Løvborg
Anteil nimmt
und wie die
Gesamtsituation
sie
beeinflusst
und damit
bedrückt.
Dem
Darsteller
des aus der
Konvention
ausbrechenden
'Künstlers'
Løvborg
gelingt, die
Labilität in
der Figur
deutlich zu
machen,
Intelligenz
reicht dann
doch nicht
allein aus,
das Leben zu
gestalten,
es braucht
auch eine
Portion
Handfestigkeit,
aus ihr
etwas zu
machen. Ihm
fehlt gerade
letzteres,
nur durch
das
Eingreifen
von Thea
gelingt es,
ihn auf die
'rechte
Bahn'
zurückzubringen
und seinem
Leben einen
Inhalt zu
vermitteln.
Der Tesman
ist ein
lockerer,
unkomplizierter,
etwas
trotteliger,
schnoddrig
daherredender
Wissenschaftler
'aber,
sag mal, was
sollen wir
mit den
beiden
leeren
Zimmern
hinter dem
Arbeitszimmer
da und
Heddas
Schlafzimmer
anfangen',
dem man kaum
abnimmt,
ausgerechnet
diese Dame
Hedda sich
zur Frau
gewählt zu
haben. Ein
Aufgeweckterer
- dass die
beiden
Zimmer auch
für Kinder
genutzt
werden
könnten,
fällt ihm
nicht ein -
hätte sich
auf das
Unternehmen
nicht
eingelassen,
aber Ibsen
wollte den
Tesman so
naiv,
weltfremd,
realitätsfern.
Er fragt die
Tante, wie
viel das
ganze
Unternehmen
Villa kosten
wird, er
selbst weiß
es nicht,
einzuschätzen.
Als Tante
Julle wissen
will, ob er
ihr nicht
nach dieser
doch
längeren
Hochzeits-
und
Studien-Reise
etwas
mitzuteilen
habe - wie
z.B. eine
eventuelle
Schwangerschaft
Hedda's -
antwortet er
mit einem
flapsigen
"Nö!" zieht
das "ö" auch
noch nach
und nach
oben, so
dass ein
"Nöhö"
daraus wird,
er habe ihr
doch schon
alles am
Telefon
gesagt. Oder
seine Frage,
an die Tante
gerichtet,
klingt: "Was
hast'n du'dn
da für'n
Käppi auf"
ist
beispielhaft
im
Gleichklang
zur
Übertragung
des Werkes
ins Heute zu
sehen.
Typisch
seine, die
Daseinsberechtigung
als Mann
unter Beweis
stellenden
animalischen
Jubelschreie
bei Hedda's
Verkündung
ihrer
Schwangerschaft,
'ich werde
Vater, habe
mich
verwirklicht'
- ob vom
Autor auch
so gewünscht
- oder dass
er Heddas
Selbstmord
mit einem
lapidaren 'jetzt
hat sie sich
erschossen'
kommentieren
soll, ist
zweifelhaft.
Man könnte
die
Darstellung
so
interpretieren:
'Ach Gott,
wenn schon,
nun ist sie
tot. Ich
habe zu tun,
rekonstruiere
jetzt mit
Thea das
Løvborgs
Buch über
die Kunst
der Zukunft,
da ist Hedda
doch nur
hinderlich.'
So viel hat
er während
des engen
Beisammenseins
mit Hedda
während der
monatelangen
Hochzeits-/Studienreise
doch nun
gelernt,
'mit der ist
nichts
anzufangen'.
Und so zeigt
die
Darstellerin
der Hedda
diese Figur.
Sie selbst
will zwar
bestimmen,
gerät aber
doch über
ihre
unintelligenten
destruktiven
Machenschaften
ins Abseits.
Brack hat
sie wegen
der
Weitergabe
der Pistole
in der Hand,
er will sich
auf seine
Art um sie
kümmern. Hat
sie eben
noch wegen
des
Dreiecksverhältnisses
mit Brack
kokettiert,
so zeigt
sich jetzt
eine von ihr
nicht mehr
steuerbare
Schieflage,
wobei ihr
bei ihrer
Frage, womit
sie bei
seiner und
Theas
Rekonstruktion
von Løvborgs
Entwurf zu
seinem
neuesten
Buch helfen
könne, die
Tesman mit
einem klaren
'Nein,
absolut
nichts.'
beantwortet,
klar wird,
dass sie aus
dem Spiel
ist.
Sie zieht
die
Konsequenz
und schießt
sich aus der
von ihr
gegenüber
Løvborg
aufgestellten
Forderung
'der
Schönheit
wegen' in
die Schläfe.
Feigheit vor
eigenen
Entscheidungen
kann Hedda
nicht
vorgeworfen
werden.
In der
Heute-Fassung
ist es ist
weniger der
Skandal, den
sie
fürchtet, am
Selbstmord
von Løvborg
durch die
Weitergabe
der Pistole
aus ihrem
Besitz in
der Hand an
ihn
beteiligt,
sondern als
Nichtswürdige
von Thea und
Tesman
ausgegrenzt
zu sein, da
die beiden
sich in die
Wissenschaft
zu vergraben
in der Lage
sind und sie
nicht
mithalten
kann.
Brack
dagegen
sieht die
Schlagzeilen,
die ihn als
Jurist in
Schwierigkeiten
bringen
könnten und
im
Originaltext
sagt er:
"Aber um
Gotteswillen
- so etwas
tut man doch
nicht!"
In
Ostermeiers
Inszenierung
ist diese
Textpassage
gestrichen
und so
kümmert
sich keiner
nach dem
Schuss um
Hedda,
keiner
schaut mal
nur um die
Ecke in den
Gang, in dem
sie liegt,
niemand
nimmt -
selbst im
Tod - mehr
Kenntnis von
ihr.
Hiermit
wollte man
die Perfidie
deutlich
machen -
hieß es von
Seiten der
Schaubühne.
|
|
|

|
|
|
Der
Darsteller
des Tesman
sieht sich
nach eigenen
Worten in
einem
TV-Interview
als Teil der
'Bravo-Generation',
er wollte
immer
berühmt
werden,
entweder
ewiger Fan
bleiben oder
selber auf
das Poster
kommen. Der
Mann ist ja
aber auch
wahnsinnig 'busy'
- spielte
eben in
seinem
ersten
Kinofilm
'Alle
anderen',
ist mit 33
Jahren
Schauspieler,
Regisseur an
der Berliner
Schaubühne,
ist DJ,
Dozent und
Vater der
Tochter
Edda.
Muss er sich
etwas
beweisen?
Meint er für
das Leben
nur wenig
Zeit zu
haben?
Geht nicht
bei dem
Tempo und
Fülle der
Aufgaben
nicht 'über
kurz oder
lang' die
Intensität
auf der
Bühne
verloren?
Bereits
jetzt merke
er bei
seinem
Hamlet, wie
sehr ihn die
Vorstellungen
ermüden, wie
er an einem
Abend
bestimmt
drei Punkte
erreiche, an
denen er
feststelle,
dass er
gleich tot
umfalle,
wenn er
nicht die
Chance
bekomme,
einzuatmen.
Immer so in
einem
Grenzbereich
zu spielen,
wo es
körperlich
schon nicht
mehr gehe.
Proben
strengten
ihn an, vor
allem, wenn
sie ihm
keinen Spaß
machten,
dann arte
das in
Arbeit aus.
Es würde an
der
Schaubühne
viel
geredet, im
Vorfeld
etwas zu
konstruieren,
was dann
umzusetzen
sei.
Regiearbeit
fordere ihm
Respekt ab.
Immerhin sei
ja eine
Probe "von
vorne bis
hinten" zu
leiten, er
sei ja
verantwortlich,
ob er es in
den Griff
bekomme,
wären
beispielsweise
drei im
Ensemble
unglücklich,
kippe die
Stimmung.
Mit seiner 'Räuber'-Inszenierung
im Studio
der
Schaubühne
sei er
"total
zufrieden",
aber es sei
ihm viel zu
anstrengend
gewesen. Als
Schauspieler
löse sich
die ganze
Arbeit, die
ganze
Investition
irgendwann
in einem
Spielrausch
auf, was bei
der
Regieführung
nicht der
Fall sei.
Es sei für
ihn wichtig,
seine
Grenzen
auszutesten,
er müsse
sich dem
allem
aussetzen,
täte er das
nicht,
bekäme er
garnichts
zurück und
das sei für
ihn "viel
anstrengender".
Gehe er aber
an seine
Grenzen, und
merke, es
würde etwas
freigesetzt,
"dann kann
man
unendlich
Energie
mobilisieren."
|
|
|

|
|
|
Es stört,
dass
Darsteller
noch
unmittelbar
vor der
Vorstellung
im
Kaffeehaus
vor der
Schaubühne
am Lehniner
Platz mit
Besuchern
ratschend sitzen
und 'der
Tesman' mit
Handy
telefonierend
vor dem
Theater auf
und ab geht,
dann als
Regisseur
seine
'Räuber-Truppe'
im Studio
noch schnell
betreut und
kaffeeschlürfend
zum seinem
Auftritt in
'Hedda
Gabler' ins
Haupthaus
schlendert.
All das hat
mit
Disziplin
nichts zu
tun und
schadet dem
Image,
selbst wenn
man das
heute als
'Publikumsnähe'
bezeichnet.
Derartiges
Verhalten
ist möglich
in
Metropolen,
wie die der
Oberpfalz,
wenn
Orchestermusiker
vor der
Vorstellung,
in der Pause
sich zum
Publikum
gesellen
oder der
Dirigent und
hier auch
noch der
Generalmusikdirektor
sieben
Minuten vor
Beginn eines
'Don
Giovanni'
noch im
Graben sitzt
und sich mit
der
Begleitung
der
Rezitative
vertraut
macht.
Unglaublich!
Das hat vor
Einlass zu
geschehen.
Dieser GMD
geht ja nun
und dann
folgt in
drei Jahren
der ad
interim
verpflichtete
musikalische
Oberleiter
wie auch der
jetzige
Regensburger
Theaterdirektor
-
hoffentlich
wird dessen
Vertrag
nicht
verlängert,
weil dem
Ober-Bürgermeister
der
Metropole
der
Oberpfalz*
wegen dessen
Kenntnissen
und
Fähigkeiten
im Bereich
Kunst und
Kultur, die
ja in
Regensburg
Chefsache
sind, nur
einer
einfällt,
den er in
das Amt des
Intendanten
setzen
könnte.
So steht
zu
befürchten,
dass er den
bis 2oo2 als
kaufmännischen
Leiter des
Theaters
Regensburg
Tätigen mit
der Aufgabe
des
Intendanten
betrauen
wird.
Frau K. aus
R. wird es
freuen und
sie sich
erinnern an
-
'Die
Stunde, da
wir nichts
voneinander
wussten.'
(*Aussage
des
Regensburger
OB am
17.3.2005 -
man wolle
mehr sein
als die
Metropole
der
Oberpfalz)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|