| |
Otto Brahm, Präsident der
Theatergemeinde 'Freie Bühne' - gerade in Berlin von
Theaterkritikern neu gegründet - spielte Stücke in diesem Verein
außerhalb der Öffentlichkeit unter Umgehung der preußischen
Zensurbestimmungen gemäß der Hinkeldeyscher Verordnung von 1851,
welche die Einreichung von Werken zur Begutachtung und damit die
Handhabung der Theater-Zensur für Berlin regelte. Der Verein sah
sich zur Veröffentlichung neuer Werke - meist unbekannter Dramatiker
- verpflichtet.
Das erste der sozialkritischen Dramen der Naturalisten war am 20. Mai
1882 'Gespenster' von
Ibsen.
1889 folgte die Uraufführung
von Hauptmanns 'Vor Sonnenaufgang', die mit einem Theaterskandal
endete:
Als am 20. Oktober 1889 Gerhart Hauptmanns
soziales Drama „Vor Sonnenaufgang“ im
Berliner Lessingtheater vom Theaterverein
„Freie Bühne“ uraufgeführt wurde, kam es zum
Skandal. Der anwesende siebenzwanzigjährige
Autor, zu dieser Zeit noch weitgehend
unbekannt, wurde vom echauffierten Publikum
lautstark ausgepfiffen. Der Augenzeuge
Adelbert von Hahnstein schrieb später: „Von
Akt zu Akt wuchs der Lärm […] schließlich
lachte und jubelte, höhnte und trampelte man
mitten in die Aufführung hinein und als der
Höhepunkt des Stücks nahte, erstieg auch das
Toben seinen Gipfel“.[1]
Auf die Spitze trieb es wohl der bekannte
Berliner Arzt, Journalist und „gefürchtete
Premierenrowdy“[2] Dr. Isidor
Kastan. Dieser schwang während des fünften
Aktes, wo dem Text zufolge „deutlich das
Wimmern der Wöchnerin“[3] zu
hören sein sollte, eine Geburtszange[4]
über dem Kopf und bot laut rufend seine
Dienste als Arzt an. Dabei kümmerte es ihn
auch nicht, dass man gerade um Tumulte zu
verhindern, diese prekäre Stelle für die
Theateraufführung gestrichen hatte. Infolge
der Störung Kastans schwoll der Lärm im Saal
derart an, dass die Schauspieler das Stück
nur mühsam zu Ende bringen konnten. [...]
Zitatende
Quelle: https://m.bachelor-master-publishing.de/document/297586
|
Ein Skandal, da zum ersten Mal in Deutschland ein soziales Drama auf
naturalistische Weise präsentiert, also auf eine zurückhaltende
Aufführungspraxis verzichtet, wurde - und z.B. eine schwangere Frau auf
der Bühne erschien. So etwas durfte damals nicht gezeigt werden. Vor allem
die Schreie einer Gebärenden im Hintergrund
erregten
das Publikum.

Brahm übernahm 1894 die Leitung des Deutschen Theaters und machte
Hauptmann zu seinem Hausdichter.
Als dieser 1912 seinen 50. Geburtstag feierte,
schrieb Otto Brahm an
ihn:
|
Zitat
Seit diesem Herbsttag von 1889 habe ich fast ein jedes
Deiner Werke auf die Bühne stellen dürfen, ich habe es
hochhalten dürfen im Licht und es dem deutschen Publikum
zuerst offenbart und dieses Tauf- und Ehrenamt empfinde
ich als das größte Glück, das in meinem Berufsleben mir
zuteil ward.
Zitatende
Quelle: https://www.jstor.org/stable/403067 |
Brahm fühlte
sich dem Naturalismus verpflichtet, einer Epoche in der
Theatergeschichte,
die sich von Frankreich (Émile
Zola) und Russland
(Leo Tolstoi) verbreitete. Der Russe Konstantin Stanislawski war ein Vorreiter des
Darstellungs-Stils der naturalistischen Werke, der sich dann später
in den USA im acting-theater verbreitete und in Deutschland im Populärjargon als ein „Wie-im-Leben“-Stil
charakterisiert wurde.
Hierbei nutzte er auch der Sekundenstil, dessen Anwendung die volle Deckungsgleichheit von
Erzählzeit und erzählter Zeit war. Dabei wurden Sinneswahrnehmungen,
Bewegungen oder Bildfolgen „sekundengenau“ erzählend registriert.
Beispielhaft hier
maßgeblich das Hauptmann'sche Prosawerk 'Bahnwärter Thiel' von 1889 oder
eben seine Schauspiele:
Vor Sonnenaufgang
(1889)
Die Weber (1892)
Der Biberpelz (1893)
Fuhrmann Henschel
(1898)

Brahm führte
seine Berliner Bühnen als Privattheater, die ohne Subventionen
auskommen mussten.
Er spielte Stücke in einer Mischung aus besonders gängigen und beim
Publikum beliebten Werken und solchen, die anfänglich Mühe hatten,
sich durchzusetzen oder dann doch vom Spielplan genommen werden
mussten, weil das Publikum ausblieb.
Er analysierte den Text eines neuen Stückes, um so die Aufführung
ganz auf die spezifischen Eigenheiten auszurichten.
Die Schauspieler wurden angehalten, nicht – wie bisher üblich – zu
deklamieren, sondern natürlich, realistisch und psychologisch
nachvollziehbar zu agieren.
Schauspieler zu einem natürlichen Spiel zu bringen, stellte sich als
besonders schwierig dar, da die Ensembles und auch Publikum bisher
das große Pathos in Sprache und Gesten gewohnt waren.
Sie hatten nun das star-mäßige Hervortreten (besonders hervorzuheben
hier ist Emil Devrient) zu unterlassen und die Gestaltung des Wortes
und damit der Rolle aus der Handlung in Gebärde, Mimik, Maske,
Haltung und Bewegung nach seinen Vorstellungen und Vorgaben als
Regisseur zu übernehmen.
Brahm half in den ersten Jahren, bis sein Gestaltungsstil von allen
seinen Schauspielern übernommen wurde, indem er ihnen die Rollen
vorspielte und dabei so übertrieb, dass auch die im Pathos
Festgefahrendsten erkannten, dass sie so nicht mehr in der
Entwicklung des Ensembles weiterkommen würden.
Erinnert sei hier an eine Situation, als Adele Sandrock an den
geschlossenen Vorhang trat, durch das Guckloch in den Zuschauerraum
spähte, Schnitzler, mit dem sie einmal eine Affäre hatte, entdeckte
und ihr mit höchstem Pathos und rollendem 'R' ein entsetztes "Mein
Gott, ist der alt geworden!" entfuhr.
Hannover folgt einer Mode, in der Werke großer Könner seziert und
gekürzt, Rollen gestrichen werden, bis alles Fleisch des Originals
entfernt ist, nur noch das Gerippe übrigbleibt und dann dieses mit
meist dünner, neuer Haut überzogen wird.
Man geht da den Weg des geringsten Widerstandes, indem das
Erfolgreiche bestehen bleibt, das auch dem Publikum mit dem großen
Namen in Verbindung gebracht wird und ihm das Notwendige überstülpt.

|
Originalrollen
Zitat
Handelnde Menschen
KRAUSE, Bauerngutsbesitzer
FRAU KRAUSE, seine zweite Frau
HELENE, Krause's Tochter aus erster Ehe
MARTHA, Krause's Tochter aus erster Ehe
HOFFMANN, Ingenieur, verheirathet mit Martha
WILHELM KAHL, Neffe der Frau Krause
FRAU SPILLER, Gesellschafterin bei Frau Krause
ALFRED LOTH
DR. SCHIMMELPFENNIG
BEIBST, Arbeitsmann auf Krause's Gut.
GUSTE, Magd auf Krause's Gut
LIESE, Magd auf Krause's Gut
MARIE, Magd auf Krause's Gut
BAER, genannt Hopslabaer.
EDUARD, Hoffmann's Diener.
MIELE, Hausmädchen bei Frau Krause.
DIE KUTSCHENFRAU.
GOLISCH, genannt Gosch, Kuhjunge.
Zitatende
Quelle: Gerhart Hauptmann - Vor Sonnenaufgang -
https://www.gutenberg.org/files/52218/52218-h/52218-h.htm
|
Die
so genannte 'Baseler Dramaturgie' findet sich auch bei der
Hannover'schen-Produktion. Hier ist das
Original-Ensemble des Stückes bei der Uraufführung auf sieben
agierende Figuren abgespeckt.
|
Theater Regensburg
Zitat
Vor Sonnenaufgang
von Ewald Palmetshofer (*1978) nach Gerhart Hauptmann
Berlin, 20. Oktober 1889: Im Zuschauerraum der Freien
Bühne am Lessing-Theater bricht ein tosender Tumult aus.
Menschen schreien durcheinander, leisten sich wahre
Wortschlachten und diskutieren sich die Köpfe heiß; ein im
Parkett sitzender Arzt wirft aus Protest gar seine
Geburtszange auf die Bühne.
Diese Aufregung war der Uraufführung des Sozial-Dramas „Vor
Sonnenaufgang“ geschuldet. Der Skandal machte den jungen
Dramatiker Gerhart Hauptmann über Nacht bekannt und
etablierte den Naturalismus auf den deutschen Bühnen.
Nun hat sich ein ebenfalls junger Dramatiker daran gemacht,
diesen Klassiker des deutschen Naturalismus zu
überschreiben: Der bekannte und preisgekrönte Theaterautor
Ewald Palmetshofer erhielt dafür den Auftrag vom Theater
Basel. Der Stoff eignet sich bestens für eine
Grundüberarbeitung, denn im Original steht die heute nicht
mehr zeitgemäße Determinationslehre rund um das Thema
Alkohol. Palmetshofer möchte den Stoff dem heutigen
Zuschauer nahe bringen: Dafür dringt er zum Kern des Stückes
durch und holt die Grundsituation der Familie Krause in die
Gegenwart. Er konzentriert sich ganz auf die
zwischenmenschliche Ebene.
Der Beginn des Stücks erinnert eher an eine Familiensoap mit
den üblichen Neckereien zwischen den Mitgliedern, doch
schnell wird klar, dass die verschiedenen Protagonisten in
dieser heilen Stubenwelt alles andere als glücklich sind.
Mit klarer und moderner Sprache zeigt sich eine
Familienhölle, in der der Alkoholismus nur noch eine
Begleiterscheinung ist, vielmehr steht das Thema Depression
im Raum. Mit wissenschaftlicher Präzision nimmt Palmetshofer
diese modernen Menschen ins Visier.
Alfred Loth besucht seinen ehemaligen Studienfreund Thomas
Hoffmann, der auf die Niederkunft seiner Frau Martha wartet.
Zwischen dem linken Journalisten und dem
rechtspopulistischen Politiker entbrennt bald ein Streit,
der exemplarisch für unsere auseinanderdriftende
Gesellschaft steht. Während des Besuchs entspinnen sich auch
zärtliche Gefühle zwischen Loth und Marthas jüngerer
Schwester Helene. Palmetshofer hält die Lupe nicht auf die
unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen
Gesinnungen, sondern auf das, was darunter brodelt:
Hoffmanns Hass auf und Angst vor Loth, der seine Karriere
vernichten könnte, ist ebenso greifbar wie Loths feige,
heimliche Flucht kurz vor der Totgeburt, als er vom
Familienarzt vor der gesundheitlichen Lage der Familie
gewarnt wird. Und doch geht am Ende unbarmherzig die Sonne
auf und die Welt dreht sich weiter, so als wäre nichts
geschehen.
Aufführungsdauer ca. 2 Stunden 45 Minuten, inkl.
Pause
Besetzung
Zitatende
Quelle: Theater Regensburg
|

Verbote und Zensur bestimmten in der
nachnapoleonischen Zeit das Leben
Europas - so auch später
im Deutschen Reich.
Die von Bismarck damals erlassenen Sozialistengesetze verhinderten das
Aufkommen der Opposition und der Kanzelparagraph verbot die
Verbreitung von Meinungsäußerungen innerhalb einer Predigt.
Über eine Geburt durfte in aller Öffentlichkeit nicht
geredet werden.
|
Zitat
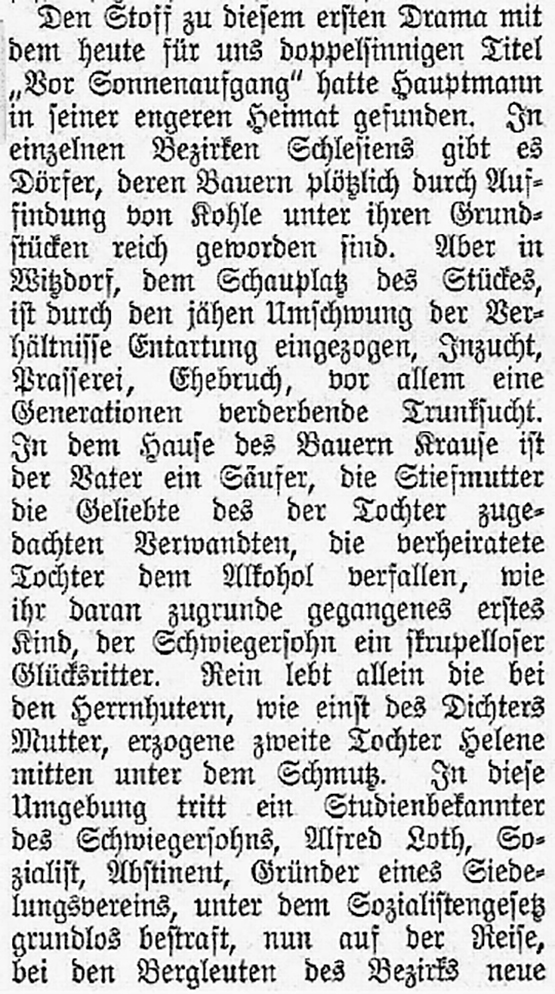
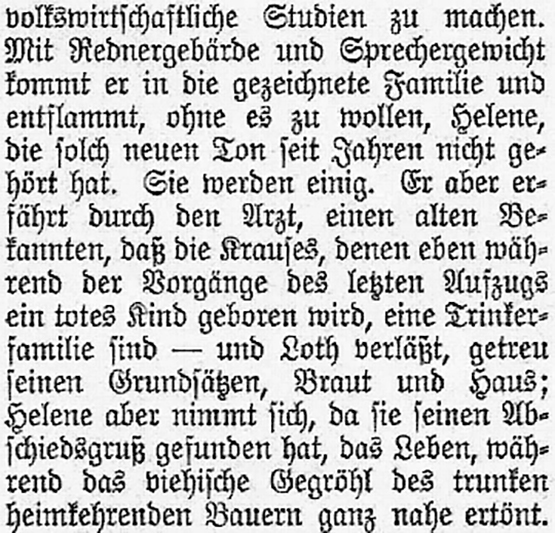
Zitatende
Dr. Heinrich Spiero - Gerhart Hauptmann - Verlag Velhagen &
Klasing - 1910
|

Die deutsche
Gesellschaft befand sich am Ende des 19. Jahrhunderts in einem Umbruch, als durch die sich
ausweitende Industrialisierung Menschen aus den Randgebieten des
Reiches in die Großstädte zogen, um der Verarmung auf dem Land zu
entgehen. Die Konsequenz war hier Ghettobildung, Mietskasernen mit
vielfachen Hinterhöfen, in denen die Menschen in viel zu kleinen
Wohnungen hausten.
Aufgrund geringer Bildung war es ihnen auch kaum gegeben, sich
sozial durch gut bezahlte Anstellungen abzusichern.
Armut und Mangel dann auch hier
- wie auf dem Land - in den Städten.
Hauptmann
selber lebte in Gasthöfen, die von den Familien betrieben
wurden, kannte also Alkoholismus im
Waldenburger Land, dem Kohlegebiet in Schlesien.
Hier sah er auch, dass Bauern und gemeine Feldarbeiter, die bisher
mühsam die Äcker der Großgrundbesitzer bestellten, nun - da Kohle
gefunden wurde - unter schwierigsten Bedingungen untertage schuften
mussten.
Das Sanatorium
„Korona Piastowska“ wurde von der Familie Hauptmann als Hotel „Zur
Krone“ betrieben und nannte sich ab 1872 „Zur preußischen Krone“. Es
ist das Geburtshaus der Brüder Carl und Gerhart Hauptmann.
Er zog
nach
Berlin und pflegte dort Kontakt zur Literarischen Gruppe "Durch", in der
sich in den 1880er Jahren deutsche Schriftsteller des Naturalismus
versammelten. Die Gruppe trat für eine Modernisierung der Literatur
und für eine unverfälschte Darstellung der sozialen Realität ein.
Hauptmann greift in seinem 'Vor Sonnenaufgang'
auf die Determinationslehre
zurück,
wonach der Mensch nicht selbstbestimmt und frei in seinen Entscheidungen und Möglichkeiten
ist, sondern maßgeblich geprägt und begrenzt wird durch die
Faktoren
-
Vererbung (erbliche Belastung),
-
Milieu (Umwelt) und
- Erziehung.
Er bezieht - damals aktuelle - Ereignisse in die Handlung, wie den großen
Bergarbeiterstreik von 1889 und die Verfolgung von Sozialdemokraten
im Breslauer Sozialistenprozess von 1887 ein, zeigt an der
Bauernfamilie Krause, die durch Kohlenfunde auf ihrem Landbesitz zu
Vermögen kam, nun aber durch mangelnde Charakterstärke immer mehr
ins Elend abdriftet. Da gibt es den Alkoholismus, der nach der
damaligen Auffassung auf die Nachfahren übertragen wird und zur
Zerstörung der unmittelbar betroffenen und sich im unmittelbaren
Umfeld befindlichen Menschen, wie Angestellte, Hilfskräfte - früher
Gesinde - beiträgt.

Nach Meinung
des Theaters Regensburg - damals vertreten durch die Dramaturgin Zinsser-Krys - könne man das Stück in der Originalform mit allen
Facetten des Lebens und dem Verfall einer Familie in ihrer
Umgebung mit Menschen, in der damaligen Zeit, nicht mehr spielen.
Man müsse aktualisieren.
Hier liegt nun die Fehlbewertung der
deutschen Theaterbetriebe, dass man Klassiker nur im Heute spielen könne.
So kommt es zu den Abweichungen in der Gestaltung der Spielpläne,
die Stücke nicht mehr in der Originalform ausweisen, sondern nur -
oder fast ausschließlich - als 'nach Schiller', 'nach Kleist', 'nach
Goethe' etc. zu spielen.
Das gilt natürlich nicht nur für das Schauspiel, sondern auch für
das Musiktheater, bei dem dann die 'Aida' in der Stasizentrale in
Berlin spielt oder die 'Manon' in einem U-Bahnhof oder die 'Rusalka'
in einem Sezierraum einer pathologischen Praxis.
Die Regensburger 'Vor Sonnenaufgang'-Produktion
handelt nach den Vorgaben eines 'Herrn Palmetshofer', der in Basel
als Dramaturg saß und nun in München residiert und der dem Meisterwerk die
neue Haut über das Gerippe des Gerhart Hauptmann-Stückes zog.
Die Reste des
Original wurden in Regensburg von einem Herrn Teufel
als Regisseur und einem Herrn Lindner als Bühnenbildner in Szene
gesetzt.

Screenshot: Theater Regensburg
Palmetshofer-'Vor Sonnenaufgang' in Regensburg ein leerer Raum
mit wenigen am Boden abgestellten Requisiten, der nur den inneren
Zirkel der Familie zeigt, das übrige Personal - eben das Gesinde -
nicht darstellt.
Der Palmetshofer'schen Version des
Hauptmann'schen Originaltextes fehlt also das Aufzeigen des sozialen
Milieus, der Gesamtsituation, so dass ein Gefälle
innerhalb der Gesamtgesellschaft zwischen up and down - hier stellt
sich die Frage, warum TV-Serien wie 'Das Haus am Eaton Place' oder 'Downton
Abbey' so erfolgreich sind - nicht erkennbar wird.
Hierin liegt aber
an sich die Spannung innerhalb des Werkes - das Oben und
Unten, das Links und Rechts in der Zeit, in der das Stück vom
Original-Autor
angelegt wurde.
Den Darstellern wird in dieser kastrierten Form des Hauptmann'schen
Werkes die Möglichkeit genommen, die Figuren so wie sie
eigentlich vorgegeben sind, zu prägen und von innen heraus zu
gestalten unter Berücksichtigung von z.B.:
- Gefängnisaufenthalt Loth's wegen
Gründung des sozialutopischen
Vereins 'Vancouver-Island'
- Alkoholismus als vererbare Krankheit & Inzest als größte
Belastungen
der Bauernfamilien
- Loth sieht Sozialismus als Lösung der damaligen sozialen Fragen
- Schuldige bieten wenig Angriffsfläche für Schuldzuweisungen, da
ihr
Handeln durch die Krankheit eingeschränkt ist
- sozialer Stand abhängig vom Milieu der Herkunft
Ausbruch nicht möglich
"Es ist zum Beispiel verkehrt, wenn der im Schweiße seines
Angesichts Arbeitende hungert und der Faule im Überdruss leben darf.
- Es ist verkehrt den Mord im Frieden zu bestrafen und den Mord im
Krieg zu belohnen. [...] Verkehrt ist es dann, die Religion Christi,
diese Religion der Duldung, Vergebung und Liebe, als Staatsreligion
zu haben und dabei ganze Völker zu vollendeten Menschenschlächtern
heranzubilden."
(Loth, 2. Akt)
Wo
blieb das alles in dem 'Regensburger Flickwerk'?
Und
in
Hannover?
|
Zitat
DIE UNVOLLENDETE REVOLUTION
Anmerkung zu einem ethischen Problem im sozialen Drama
Hofmannsthals Wort »Die Gestalt erledigt das Problem« gilt
nicht für eine der umstrittensten Bühnenfiguren Gerhart
Hauptmanns. Das ethische Problem, das sich in dieser recht
genau nach der Realität gezeichneten Figur stellt, ist bis
zum heutigen Tage in unserem sozialen Leben nicht gelöst
worden, und es macht auch unseren Dramatikern weiterhin
schwer zu schaffen.
Alfred Loth, nach Paul Fechter »der erste Volkswirtschaftler
der deutschen Bühne«, versagt in der konkreten Situation, in
die er gestellt ist, in zwiefacher Hinsicht: sachlich und
ethisch. Er versagt sachlich, weil er die im Elend
steckenden Grubenarbeiter im Stich läßt. Er versagt ethisch,
weil er, im Wissenschaftsaberglauben seiner Zeit befangen,
ein ihn liebendes Mädchen verläßt, die durch ihn sehend
Gewordene in den Selbstmord treibt. Dem einzigen Menschen
also, dem Loth wirklich helfen könnte, hilft er nicht. Loth
will eine neue, bessere, humane Gesellschaft erkämpfen. Um
dieser hohen Mission willen lehnt er es ab, sich mit dem
leidenden Einzelmenschen abzugeben, ihm Opfer zu bringen.
Alfred Loth ist Fanatiker. Fanatiker als Bühnenfiguren zu
verwenden, bleibt eine problematische, mißliche Sache.
Gerhart Hauptmann wußte das. Er schrieb einmal: ',Fanatiker
sind im Drama nur episodisch zu verwerten: ihr unbewegliches
Wahnsystem ist bald heraus und die Standhaftigkeit, mit der
es behauptet wird, ebenfalls: darüber hinaus gibt es dann
nichts, was dem Leben des Dramas noch förderlich sein
könnte.« Trotz dieser von hohem Kunstverstand zeugenden
Einsicht hat Hauptmann In seinem Drama »Vor Sonnenaufgang«
einen Fanatiker zur Hauptfigur gemacht. Nimmt man zwei
weitere dramaturgische Bemerkungen des Dichters hinzu so
versteht man besser, warum Zuschauer und Kritiker seit der
Uraufführung des Stückes vor nun mehr als siebzig Jahren die
Figur des Alfred Loth immer wieder als problematisch oder
unbefriedigend empfunden haben.
Die erste Bemerkung lautet: »Die Distanz, aus der man ein
Drama sieht, darf sich während der Arbeit nicht
verschieben«, die zweite: »Episodenfiguren können geschaut,
Gestalten des engeren Dramas müssen gelebt sein.« Die Figur
des Loth wurde gelebt. Und hier nun liegt ein doppelter,
ungelöster Widerspruch: der Fanatiker Loth, eigentlich nur
als Episodenfigur geeignet, wurde Hauptfigur und war doch
zugleich ein Teil dessen, was Gerhart Hauptmann in seiner
Jugend gewesen war.
Aus der Biographie und Autobiographie des Dichters wissen
wir, wie sehr die revolutionären Gedanken, die Alfred Loth
äußert, von dem Jugendfreunde Carl und Gerhart Hauptmanns,
dem späteren Rassenhygieniker Dr. Alfred Ploetz, proklamiert
worden waren und wie stark sich der Junge Dichter mit ihnen
verbunden gefühlt hatte.
Zitatende
Kurt Lothar Tank - Jahrhundertfeier Gerhart Hauptmann -
Stadt Köln 1962
|
Gezeigt
wurde am Nds. Staatsschauspiel in Hannover nur die innere Rahmenkonstruktion eines Fertighauses.
Die damals krassen Bevölkerungs-Gegensätze
- zwei Welten - dem Publikum vorzuführen, wie sie sich eben in der
Mitte und am
Ende des 19. Jahrhunderts vor Festelegung der Sozialgesetze darstellten,
bleiben außen vor.
Dies nahezubringen - hierin liegt aber die Aufgabe eines Theaters, die Situation
- das
Elend, die Freude in der damaligen Zeit - darzustellen.
Das Original
ins Heute zu zerren, entspricht nicht dem Bildungsauftrag,
somit wurde das Thema 'Vor Sonnenaufgang' in Regensburg wie in
Hannover verfehlt
dargestellt und entsprechend öffentliche Gelder verschwendet.
In
dieser Form kann man 'Vor Sonnenaufgang' auch als Hörspiel senden.
Für ein Spiel in einer Szenerie mit Kostümen auf dem Theater besteht
keine Notwendigkeit.
Die mangelnde Akzeptanz durch das Regensburger Publikum sprach für
sich. Die Auslastung betrug nur 70%. Bei der Vorstellung am 2. Juni
2019 befanden sich lediglich sieben Personen im dritten Rang, die
allerdings auch nach der Pause.
|
 |
Das
Internet zeigte am 25.4.25 - dem Tag der zweiten Vorstellung in Hannover
- nur folgende Auslastung:
Die farbig
- in gelb, blau, grün - angelegten Flächen dokumentieren die nicht verkauften Plätze.
Der
Balkon wurde überhaupt nicht angeboten.
Die von Hauptmann vorgesehen unterschiedlichen Szenen
- mit
1. Akt - 'Zimmer' des Wohnhausees
2. Akt - Auf dem Gutshof, am nächsten Morgen um vier
Uhr
3. Akt - 'Zimmer' des Wohnhauses, einige Minuten später
4. Akt - auf dem Gutshof, eine Viertelstunde später
5. Akt - im 'Zimmer' des Wohnhauses, zwei Uhr nachts bis
'Sonnenaufgang'
werden alle nur in einer einheitlichen Szenerie vorgestellt.
Allerdings führt der 'großzügige' Hannover'sche Bühnenaufbau ein Eigenleben, so
dass man davon ausgehen kann, das Staatsschauspiel wolle die
Möglichkeiten der Werkstätten aufzeigen, ein möglichst teures
Bühnenbild zu präsentieren.
Der Bühnenaufbau, der sich auf der vor ihm liegende Bühnenfläche
spiegelt - was einen zusätzlichen Effekt schafft - dreht sich mal
sich um sich selber, mal werden Teile des Aufbaus von Flächen
abgedeckt, auf die dann Bilder und Videos projiziert werden, bei
denen Bild und Ton nicht zusammenpassen - von Synchron also keine
Rede sein kann.
Auch fährt der Bühnenaufbau mal nach vorne und bringt dem Zuschauer
das Innenleben des Einfamilienhauses Krause näher.
Die Beleuchtung ist ebenfalls ein Einzelkunstwerk. Mal ist der
Bühnenraum abgedunkelt, damit die Projektionen besser zur Geltung
kommen, mal hell erleuchtet, dass jeder Darsteller seine Wege, seine
Pfade gut finden kann, dann mal gleißendes Blitzlichtgewitter und
dann zum Schluss:
"Wie gut ist's in den Mond zu sehn",
der übergroß
auf der rückwärtigen Projektionsfläche die Szene beherrscht.
Alles das hat mit dem Stück von Gerhart Hauptmann nichts zu tun,
sondern führt ein Eigenleben. Der Hannover'sche Bühnenaufbau
erschlägt den Palmetshofer'schen 'Sonnenaufgang'.
Damit wie auch beim 'Zerbrochnen Krug' in diesem Hause und unter
Leitung der Theaterdirektorin
Anders:
Thema verfehlt!
Dafür lässt sich diese - in sich schon dominante Bühnendekoration -
auch sehr gut für andere Stücke verwenden, birgt somit ein großes
finanzielles Einsparpotential. Tristan (vornehmlich der erste Akt)
oder Rusalka oder Onegin oder Krug oder Biberpelz oder Rosenkavalier
- hier besonders der 2. Akt für die Überreichung der Rose im
Faninal'schen Stadtpalais.
Diese Neufassung lässt vom Hauptmann'schen Werk kaum etwas übrig und
aus der notwendigen sozialkritischen Behandlung des Themas entstand
eine überflüssige, seichte Gesellschaftsschnulze, die durch die
fragwürdige Personenführung in Hannover noch betont wird.

Screenshot6 Nds. Staatstheater Hannover

Die Besetzung der
verbliebenen Rollen in der Palmetshofer'schen Verarbeitung des
Stückes :
Egon Krause
Lukas Holzhausen
'Die Schwarzen' in Hannover
Live-Video
Hannes Francke,
Ute Schall

Alle auf der Bühne machen sich
lautstark bemerkbar. Schauspielerisch wird nicht viel
geboten, die Herrschaften Darsteller differenzieren nicht, alles
plärrt und schreit nur den Text herunter. Und ist mal eine
verhaltene Textstelle zu gestalten, so kann man in der 6. Reihe
schon niemanden mehr verstehen, da ja Sprechtechnik an den
Ausbildungsstätten nicht mehr gepflegt wird, aus Angst, man könne
ins Deklamieren abgleiten. So jedenfalls Sprechtechniker an
Musikhochschulen als wollten die heutigen Intendanten keinen
'Endkonsonanten' oder einen deutlichen Vokal von ihrem Ensemble mehr
mitbekommen..
Dass in Hannover Tochter Martha - aus der ersten Ehe von Vater
Krause - unter der Schwangerschaft aus der Ehe mit Hoffman
leidet, ist nicht erkennbar. Der naturalistisch vorgeschnallte Bauch
erfüllt die Aufgabe nicht.
Hier macht Palmetshofer den Fehler, der Figur - im Gegensatz zum
Original von Hauptmann - einen Text zu geben.
Die Darstellerin führt sich auf wie alle
die anderen auf der Bühne - brüllt herum, um
auf sich aufmerksam zu machen. Dass sie kurz vor der Entbindung steht,
bleibt in der Darstellung der Figur verborgen.
Auch ihre Schwester, Helene, aus der zweiten Ehe von Egon Krause, die ja in einem Internat
aufwuchs und dort erzogen wurde, somit eigentlich gewisse Bildung
und Haltung durch ein gesetzteres Auftreten zeigen müsste,
stelzt in ihrem Miniröckchen durch den Abend, dass der Zuschauer
immerfort die Luft anhält - aus Sorge, 'sie tritt sich auf den
Saum'. Damit präsentiert sie sich nicht anderes als ihre am Bauerhof der Krauses
aufgewachsene und dem Alkohol verfallene Schwester bzw. Tochter des
reich gewordenen - meist alkoholisierten - ehemaligen Großlandwirts und
nun Kohlebergbaubesitzers Krause mit seiner Frau Annemarie im Gebiet östlich von
Hauptmanns Geburtsort:
| |
Ober
Salzbrunn
66 Kilometer südwestlich von
Breslau |
(Hauptmanns
Geburtsort)
Akteure sind
lokale Grundbesitzer im Waldenburger Land |
|
Steinkohle-
Ausbeutung von 1806
bis1908
|
Lieferumfang
24.271 t (1904)
|
Bauer Krause ist einfach nur ordinär und im Detail auch noch ungenau. Er kotzt
in die Closchüssel, dann setzt er sich drauf, palavert wie genau
man die Uhr nach seinem 'Morgenschiss' stellen könne.
Mutter Krause meint mit Rumgebrülle eine Anerkennung dessen
erzwingen zu können, was sie alles für Mann und Töchter tut. Wie sie
da mit dem Pappkarton rumhantiert, statt ihn ohne große
Skandalmacherei wegzuräumen - genialer Regieeinfall, der die
schauspielerischen Fähigkeiten unterstreicht..
Die drei verbleibenden Männerrollen:
- Thomas Hoffmann, der Ehemann von Martha, neureich, rotzig, hem-
mungslos.
- Alfred Loth, sanfter Revoluzzer aus Jena - dort mit der verbotenen
Studentenbewegung in Kontakt geraten, als einer von Bismarcks
verbotenen Sozialisten verurteilt und als Idealist eingekerkert.
- Schimmelpfennig, unempathischer Jung-Arzt.

Die Inszenierung in Hannover endet im Irgendwie -
- während bei Hauptmann die Helene aus lauter Verzweiflung, dass
Loth sie auf dem Bauernhof sitzen lässt, sich das Leben nimmt,
Mutter Krause die gebärende Tochter zu trösten versucht,
beschreit Martha in Hannover die Totgeburt.
Der Bühnenaufbau fährt zurück, Wolken wabern hinten-oben, eine
Projektionsfläche wird vorne szenedeckend heruntergelassen und die
Schauspielenden auf ihr im Abgehen gezeigt. Ein einzelner
Feuerwehrmann kommt hinzu, verschwindet über die Innenhaustreppe,
geht am schmusenden Alt-Bauernpaar Krause vorbei, - ein
gleißendes Licht - der Sonnenaufgang - eine Kinderstimme:
"Mama, ich will zu meiner Mama".
Gestrichen die gesamte Palmetshofer'sche Szene 9 am Ende des
Stückes:
|
Szene 9
Gleich darauf. Kurz vor Sonnenaufgang. Die Eingangstüre
öffnet sich. Helene tritt ein. Sie hat den Autoschlüssel in
der had. Sie siet sich um. Sie blickt zu Martha. Sie geht
nicht zu ihr hin. Sie geht zur Terrassentür. Sie öffnet sie.
Sie macht einen Schritt zurück, als würde sie von der hoch
immer nicht aufgegangenen Sonne geblendet werden. Dann
blickt sie sich noch mal um. Lange schaut sie und sagt
nichts.
HELENE
weg
Dann lässt sie den Autoschlüssel sinken.
Martha richtet sich ein wenig auf, gleitet mit den Füßen
voran Stufe für Stufe ans Ende der Treppe herab. Sie tritt
Hoffmann mit den Füßen weg.
Helene dreht sich um. Sie geht zu Martha, legt ihr die Hand
auf die Schulter, streichelt ihr das Haar, die Wangen, das
Gesicht. Sie küsst sie. Sie hilft ihr aufzustehen. Der
Sanitäter tritt hinzu und stützt sie.
Annemarie steht auf. Egon Krause kann nicht hinsehen.
Martha, Helene und der Sanitäter gehen zur Tür.
Hoffmann steigt die Treppe hoch.
Martha hält sich am Türrahmen fest. Mit einer Hand. Mit
aller Kraft. Der Sanitäter legt seine Hand auf ihre. Da hat
ihr Widerstand schon lange nachgelassen.
Schimmelpfennig folgt ihnen und schließt die Tür.
Hoffmann kommt die Treppe mit einer großen Damen-Reisetasche
herab. Er bleibt irgendwo stehen. Helene kommt wieder bei
der Eingangstüre herein.
Annemarie Krause steht immer noch. Ihr Mann ist eingesunken.
Und dann sehen sie es:
Die Sonne ist aufgegangen. Draußen ist alles in Licht
getaucht. Alles strahlt.
Zitatende
Quelle: Ewald Palmetshofer, 'Vor Sonnenaufgang', - S.
Fischer-Verlag
|
Die von
Palmetshofer und schon vom Hauptmann'schen Originaltext vorgebenden Stimmungsbilder werden ausgeschaltet.
Regieanweisungen fallen bei beiden Ausgaben unter den Tisch.
Ein völlig neues Werk hat Herr Pucher als Regisseur in Hannover
erfunden.
Und wenn schon, denn schon:
Wenn der schlesische Dialekt - wie im Original - nicht mehr darstellbar ist, warum nicht
auf Plattdeutsch wie das Ohnsorg-Theater in Hamburg die Mann'schen
'https://www.ohnsorg.de/events/buddenbrooks-eine-familiensaga/' zur Zeit spielt.
Auf hannöversch ganz klar:
"Jetz waßte Beschad"
Fazit
Es fragt sich, warum sich Herr von Düffel für diese Produktion
als Dramaturg hergibt, konnte er sich doch mit seiner eigenen Bearbeitung
der Mann'schen
'Buddenbrooks'
und 'Joseph
und seine Brüder' einen Namen machen.
Die Menschen - in Hannover nur in geringer Anzahl erschienen - das
Publikum nimmt die Inszenierung hin, als müsste die Darstellung des
Hauptmann'schen Werkes so sein.
Wer von den Hergekommenen kennt das Original und wer die
Bearbeitung?
Da wird in Hannover der zuständige Minister kritisiert, er kümmere
sich zu wenig und verliere sich im 'Klein, Klein'.
Hat er hier eingegriffen und Frau Anders als Theaterdirektorin drauf
hingewiesen, dass sie mit dieser Produktion des 'Vor Sonnenaufgang'
den Bildungsauftrag nicht erfüllt?
Wohl kaum!
Dabei wäre es angebracht und er würde seiner Aufgabe gerecht.
|
 |
Kritiken zu 'Vor Sonnenaufgang' in der Bearbeitung von
am Staatsschauspiel Hannover

https://www.haz.de
› Kultur › Regional
14.12.2024 — Es erzählt vom Verfall einer Familie,
von gesellschaftlicher Spaltung und der
Unmöglichkeit von Veränderung. Bei Hauptmann war
Alkohol der ...
 |
https://www.kreiszeitung.de
› Kultur
20.12.2024 —
Hannover – Das hannoversche
Schauspiel hat ein hervorragendes Ensemble. Das ist
eine erfreuliche, aber nicht besonders originelle
Beobachtung.
 |
Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:
Als Zeitungs- / Theater-Abonnent und Abnehmer von voll bezahlten
Eintrittskarten aus dem freien Verkauf verstehe ich
diese Besprechungen und Kommentare nicht als
Kritik um der Kritik willen,
sondern als Hinweis auf - nach
meiner Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes.
Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und
Satire.
Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,
Grundgesetz,
in Anspruch.
Dieter Hansing
|
|