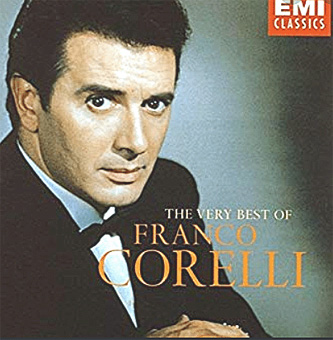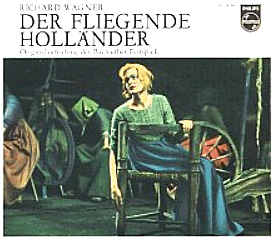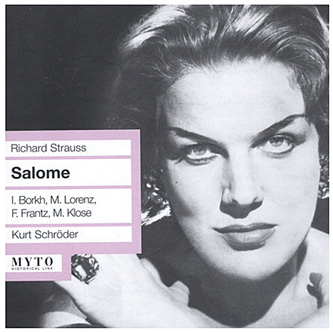| |

Nr.
30
Leserbrief
|
|
|
Zitat
"Hallo Frau Gilles,
ich kann Ihre Frage nach der Tosca in Hannover nur unjuristisch,
aber dafür in leicht verständlicher Sprache beantworten:
Selten so einen Schwachsinn gesehen!
Sie haben in Ihrer Mitschrift ja zig Punkte aufgeführt, die dem
Publikum alle völlig unverständlich bleiben... und in der Tat:
niemand weiß es (wofür).
Höhe des ganzen Unsinns ist doch der Schluss.
Da sitzt einer, der eigentlich gar nicht mehr lebt!
Mir bleibt bei all dem tatsächlich rätselhaft, warum man heute
die Musik 1:1 behält, alles andere aber in Frage stellt.
Warum nennt man das Stück dann eigentlich nicht "TOSCO" oder "TISCA"
- eine Witzoper eines No-Name-Regisseurs, der von Musik keine
Ahnung hat und deshalb - und weil es sich besser verkauft -
einfach die Musik aus Tosca nimmt.
Hanebüchen alles!
Viele Grüße
Ihr K. aus H."
Zitatende
|

Vor fünfundsiebzig Jahren
… endete das ’Dritte Reich’ nach nur
zwölf Jahren im Chaos.
Millionen von Menschen kamen während seiner Herrschaft zu Tode oder
büßten ihre Gesundheit ein. Unschätzbare materielle Werte fielen ihm
zum Opfer.
Tausende, die beim Film oder Theater tätig waren, flohen aus Europa,
ließen Heim, Hab und Gut und Bekannte zurück. Nahmen Schaden an
ihrer Gesundheit.
Viele hatten Europa auch schon der Machtübernahme verlassen oder
begingen in einer ausweglosen Situation Selbstmord.
Da waren unter anderen:
Gezielt betrieben wurde die Verfolgung der Menschen im
‘Deutschen Reich‘ durch die am 22.
September 1933 per Gesetz gegründete Reichskulturkammer. Aufgabe war,
die Kultur im Deutschen Reich unter Kontrolle zu halten und
gleichzuschalten,
Joseph Goebbels selbst
wurde ihr Präsident. Der Reichskulturkammer waren sieben einzelne
Abteilungen untergeordnet, die den gesamten Kulturbetrieb im Deutschen
Reich abdecken sollten. Dies waren Reichsfilm-, Reichsmusik-,
Reichstheater-, Reichspresse-, Reichsschrifttumskammer, Reichskammer der
bildenden Künste und Reichsrundfunkkammer.
Jeder, der sich im
Deutschen Reich der Kultur verpflichtet fühlte, als Musiker,
Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur, Komponist, Maler, musste
Mitglied der Reichskulturkammer werden. Doch die Kammer durfte eine
Auswahl treffen. Damit konnten kritische Künstler an der Ausübung ihres
Berufes gehindert werden.
So war es letztlich
nur den Künstlern möglich, ihren Beruf auszuüben, die im Sinne der
Nationalsozialisten arbeiteten. Die Künstler, die nicht aufgenommen
wurden, durften auch nichts mehr veröffentlichen und verloren die
Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es ging nicht nur darum, kritische
Stimmen auszuschalten, sondern auch um die Juden auszuschalten, da man
für die Aufnahme einen so genannten ‘Ariernachweis‘ benötigte.
Zuständig als Leiter der Sektion Film war bis 1943
Fritz Hippler,
ein Nationalsozialist von Schülerzeiten an. Er studierte Jura an den
Universitäten Heidelberg und Berlin, fiel dort durch unbotmäßiges
Verhalten auf und konnte das Studium nur durch einen Erlass des neuen
nationalsozialistischen Kultusministers
Bernhard Rust
mit der Promotion 1934 abschließen.
Danach war er mit der Herstellung von Filmaufnahmen für die Wochenschau
beschäftigt, lernte so das Filmhandwerk. Im August 1939 berief Goebbels
den 29-Jährigen zum Leiter der Filmabteilung im Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda, im Februar 1942 ernannte er ihn zum
Reichsfilmintendanten.
Er war damit verantwortlich für die Lenkung, Überwachung und Ausrichtung
des deutschen Films, so auch für die Herstellung des Films ’Der Feldzug
in Polen’ und des Films ’Der ewige Jude’.
Ein von Hippler gezeichneter Artikel in der Zeitschrift ‘Der Film‘ über
seine Entstehung bezeichnete Juden als ‘Parasiten nationaler Entartung‘.
Der Film diente als Vorbereitung und Einstimmung der Bevölkerung auf den
kommenden Holocaust und wurde vor allem zur Schulung von
Polizeieinheiten und SS-Mannschaften eingesetzt. Noch im gleichen Jahr
erhielt Hippler von Hitler als Anerkennung eine geheime Sonder-Dotation
in Höhe von 60.000
Reichsmark.
1943 entließ ihn Goebbels wegen Alkoholproblemen und weil er
verschwiegen hatte, dass seine Urgroßmutter jüdischer Abstammung war.
Nach dem Krieg und zwei Jahren Gefängnishaft, konnte er wieder arbeiten,
war verantwortlich für Werbung verschiedener Institutionen und Firmen
und betrieb bis zu seinem Tod, 2002, ein Reisebüro in Berchtesgaden
Nachfolger war ab 1943 Hans Hinkel, Sohn eines Fabrikanten, der
das Abitur in seiner Geburtsstadt Worms absolvierte, 1919/20
Staatswissenschaft und Philosophie in Bonn und München, ohne Abschluss,
studierte.
Er trat am 4. Okt. 1921 in die NSDAP ein und nahm 1923 am Hitler-Putsch
in München teil, 1928 war er
Schriftleiter
im ‘Kampfverlag‘
bis 1932 Redakteur für den ‘Völkischen
Beobachter‘ in Berlin. Von Goebbels im Juli 1935 als
Sonderbeauftragter im Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda als Leiter des Sonderreferats Reichskulturwaltung mit der
Überwachung der geistig und kulturell tätigen Juden im deutschen
Reichsgebiet – damit der ’Entjudung’ des Reichsgebietes - betraut.
1945 wurde er interniert und 1947 an Polen zur Abbüßung einer Strafe
wegen des Raubes polnischer Kulturgüter ausgeliefert. Darauf Rückkehr in
die Bundesrepublik, ohne hier für seine Taten zur Verantwortung gezogen
zu werden.
Zum Opfer fielen der Reichskulturkammer unter den vielen anderen, die
namentlich nicht mehr genannt werden können, der Operettenkomponist
Leon Jessel, der 1917 einen sensationellen Erfolg mit der Operette
’Schwarzwaldmädel’ erzielen konnte - innerhalb der folgenden 10 Jahre
rund 6.000 Mal aufgeführt -, dem aber als zum Protestantismus
konvertierten Juden 1934 Aufführungsverbot erteilt wurde.
1941 von der Gestapo verhaftet als ein 1939 von ihm an seinen
Librettisten
Wilhelm Sterk
nach
Wien
geschriebener und bei einer Hausdurchsuchung gefundener Brief, in dem
Jessel geschrieben hatte: „Ich kann nicht
arbeiten in einer Zeit, wo Judenhetze mein Volk zu vernichten droht, wo
ich nicht weiß, wann das grausige Schicksal auch an meine Tür klopfen
wird.“, gefoltert in einem Krankenhaus an den Folgen der
Qualen am 4. Januar 1942 starb.
Joachin Gottschalk, ein bekannter Theater- und Filmschauspieler
in Berlin geriet unter Druck der Reichskulturkammer, als er sich von
seiner jüdischen Frau nicht trennen, lieber mit ihr ins KZ gehen,
wollte. Da man ihm dies verweigerte, drehte er in der Nacht zum 6.
November 1941 den Gashahn auf und ging mit Frau und 8-jährigem Sohn in
den Tod.
Stefan Zweig, der für
Richard Strauss noch das Libretto zur Oper
Die schweigsame Frau verfassen konnte - die Oper wurde aufgrund
persönlicher Genehmigung
Adolf Hitlers in der Dresdner Oper aufgeführt - musste dann aber
wegen Stefan Zweig als jüdischem Textdichter abgesetzt werden.
Er floh aus Österreich über die Stationen
London,
New York,
Argentinien
und
Paraguay
gelangte im Jahr 1940 schließlich nach
Brasilien,
wo er in der Nacht vom 22. zum 23. Februar 1942
mit seiner Frau Lotte mit einer Überdosis
Veronal das Leben nahm.
Ernst Klee veröffentlichte in einem ’Kulturlexikon zum ’Dritten Reich’
„3600 Namen, die so oder so deutsche Kultur im Dritten Reich
repräsentieren. Von vielen wurden erstmals, und nicht ohne Mühe,
Lebensdaten recherchiert. Gesichert vor dem Vertuschen oder
Vergessenwerden. Alle, Täter, Vordenker, Mitläufer, wirklich
Widerständige und Opfer, gehören zu unserem kulturellen Erbe. Ein
lexikalisches Mahnmal.“
Erschienen ist das Buch im Fischer Taschenbuch Verlag – ISBN
978-3-596-17153-8
Aus Anlass des Endes des ’Dritten Reichs’ am 8. Mai 1945 ist
dieser Ausgabe der ’Mitteilung’ eine Sonderausgabe angehängt, die den
Gang der Dinge von 1933 an noch einmal - kurz gefasst und somit ohne
Anspruch auf Vollständigkeit – aus unserer Sicht aufzeigen soll.
ML Gilles


Stefan Mickisch
schreibt auf
https://www.mickisch.de/:
|
|
|
Zitat
Richard Wagner – Werktreue
Zum Thema WERKTREUE
gibt es seit vielen Jahren und Jahrzehnten eine lebendige
Diskussion, nicht nur im Zusammenhang mit den Werken Richard
Wagners.
Da der hier vorliegende Aufsatz von Herrn Dr.
Peter Brenner ganz meiner eigenen Überzeugung entspricht, möchte
ich diesen gerne und mit herzlichem Dank für die Überlassung
desselben durch den Autor hier wiedergeben.
Stefan Mickisch
Zitatende |

Ein Text von Dr. Peter Brenner:
|
|
|
Zitat
WAS
IST WERKTREUE ?
So mancher Opernbesucher, der sich durch die Inszenierung in
seinen Erwartungen getäuscht sieht und sich durch das, was er
als regieliche Willkür empfindet, vor den Kopf gestoßen fühlt,
beschwört den Begriff der Werktreue.
Wenn wieder einmal das Personal einer Händel-Oper in Wehrmachts-
oder SS-Uni-formen gesteckt wird,
- wenn sich Elisabeth im Tannhäuser, von Wolfram von
Eschenbach tatkräftig unterstützt, in einer Biogasanlage selbst
entsorgt,
- wenn Florestan im Fidelio, statt im finsteren Kerker zu
schmachten, in einer hellerleuchteten Wohnstube auf einem Sofa
sitzt, versucht, eine kaputte Stehlampe anzuknipsen und dazu
singt „Gott, welch Dunkel hier“,
- wenn Alberich im Siegfried aus einem Gummipenis auf
den am Boden liegenden Wotan pinkelt und die Begegnung von Erda
und Wotan auf der Toilette stattfindet,
- wenn ein Regisseur es zu seinem Markenzeichen macht,
irgendwelche mit Kalaschnikows bewaffnete Gestalten auf der
Bühne herumrennen und herumballern zu lassen, ganz egal, ob es
sich Tristan und Isolde, um Elektra oder um Don
Giovanni handelt, um nur einige kleine Beispiele aus einer
endlosen Reihe von „Regieeinfällen“ unserer Tage zu erwähnen,
dann fragt unser Opernfreund empört, warum man denn das Werk
nicht so spiele, wie es geschrieben sei, und er fordert eine
Realisierung, die den Vorstellungen und Anweisungen des
Komponisten entspricht.
Doch lassen Sie mich warnen: selbst wenn man sich nicht nur von
einer altgewohnten, liebgewordenen Sichtweise leiten lässt,
sondern glaubt, triftige und gewichtige Gründe für seinen
Protest zu haben, wird man sich auf höchst unsicheres Terrain
begeben, man wird einer klugen Gegenargumentation nicht
gewachsen sein, wenn man nicht einige wesentliche Faktoren
bedenkt.
Treue zum
Werk setzt dessen Kenntnis voraus, und diese Kenntnis ist auch
für die Beurteilung erforderlich, ob die Interpretation
werkgetreu erfolgt ist.
Wie viele Opernbesucher aber können mit Fug und Recht behaupten,
das Werk wirklich zu kennen? Wird ihr Bild nicht vielmehr von
einer gewissen Aufführungspraxis bestimmt, von - vielleicht
werkverfälschenden - Traditionen, von den sattsam bekannten und
abgestandenen Klischees des sogenannten modernen Regietheaters,
von irgendwelchen extravaganten Interpretationen, die aber einen
bleibenden Eindruck und die Überzeugung hinterließen, man habe
das angekündigte Stück gesehen, und bei fremdsprachigen Werken
von oft unzulänglichen, oder sogar entstellenden Übersetzungen?
Was ist denn eine Oper?
Zunächst doch nichts weiter als ein Haufen schwarzer Striche und
Punkte auf weißem Papier, dazu etwas Text, Hieroglyphen, die
entziffert sein wollen, um akustische und optische Realität zu
werden, bestenfalls ein Skelett, das erst mit Fleisch und Blut
versehen, dem Atem eingehaucht und das gekleidet werden muss.
Dieser Akt der Verlebendigung ist notwendigerweise subjektiv,
und das Ergebnis wird durch die Persönlichkeit des Nachschöpfers
geprägt. Wer daher eine Opernaufführung, und sei sie noch so
verstaubt, „museal“ nennt, gebraucht einen falschen Begriff.
Die
Problematik wird nämlich deutlich, wenn man sich einen
wesentlichen Unterschied zwischen Werken der bildenden und denen
der darstellenden Kunst vor Augen führt : Skulpturen, sofern sie
nicht beschädigt sind, Gemälde, soweit sich die ursprünglichen
Farben erhalten haben, stellen sich uns so dar, wie sie der
Künstler vor zehn, hundert oder tausend Jahren geschaffen hat.
Und niemand wird auf die Idee kommen zu behaupten, der Bildhauer
wollte gar kein mild lächelndes Antlitz, sondern eine
schmerzverzerrte Fratze meißeln, niemandem wird es einfallen zu
sagen, der blaue Himmel solle nach dem Willen des Malers
eigentlich rot sein.

Das Werk der
bildenden Kunst ist Wirklichkeit gewordene Vorstellung des
Künstlers, es ist - man verzeihe diesen kommerziell klingenden
Ausdruck - ein Endprodukt, für dessen Form und Gestalt sein
Schöpfer allein verantwortlich zeichnet. Was von einer Oper zu
hören und zu sehen ist, entzieht sich der Verantwortung des
Komponisten. Das Bildnis der Mona Lisa von Leonardo da Vinci
z.B. gibt es. Es ist im Louvre in Paris zu besichtigen. Die Oper
Così fan tutte von Mozart z.B. gibt es an sich nicht. Es
gibt nur Versuche der musikalisch-szenischen Realisierung, die
naturgemäß ein jeweils anderes Erscheinungsbild hervorbringen.
Nicht nur wird jede Inszenierung von der anderen abweichen,
sondern auch jede Aufführung der gleichen Inszenierung – selbst
mit der selben Besetzung – wird aufgrund der momentanen
Disposition der Interpreten sowie der Zusammensetzung und
Reaktion des Publikums Unterschiede aufweisen. Auch wenn wir -
bei Werken der Vergangenheit - von der Fiktion ausgehen, dass
eine Rekonstruktion der Uraufführung möglich wäre, brächte uns
das nicht viel weiter, da die Komponisten sehr oft damals schon
ihre Vorstellungen und Absichten nicht verwirklicht sahen.
Dazu kommt,
dass es uns die Komponisten selbst manchmal zusätzlich erschwert
haben, ihren Willen zu ergründen, indem sie ihr Werk umschrieben
und abänderten. Welche Fassung ist die vom Autor gewollte?
Von Verdis Don Carlos existieren sieben verschiedene
Fassungen, die vom Komponisten selbst stammen oder doch von ihm
autorisiert sind.
Von Richard Wagners Tannhäuser gibt es nicht nur die
Dresdner und die Pariser Fassung, sondern es gelangten schon in
Dresden mehrere Varianten zur Aufführung. Wagner hat zwischen
1845 und 1860 rund 70 Änderungen vorgenommen und den Schluss der
Oper nicht weniger als viermal musikalisch und dramaturgisch
wesentlich umgestaltet. Kurz vor seinem Tod äußerte er seiner
Frau Cosima gegenüber, er sei der Welt den Tannhäuser
noch schuldig, so dass man auch die letzte Version nicht als die
endgültige ansehen kann.
Mit welcher Fassung erfüllt man den Willen des Komponisten?
Natürlich kommt es vor, dass der Komponist eine Version
unmissverständlich als die einzig gültige bezeichnet, was aber
nicht ausschließt, dass sich eine andere als die
lebenskräftigere erweist.
So wollte Hindemith nur noch seine zweite Fassung des
Cardillac aufgeführt wissen, durchgesetzt hat sich aber die
erste - mit Recht, wie die Musikwelt übereinstimmend befand.
Von Belang sind auch die Gründe, die den Komponisten zur
Umarbeitung bewogen haben. Nicht immer nahm er sie aus eigener
Überzeugung vor, sondern manchmal auf Drängen von vielleicht
wohlmeinenden, aber nicht sehr weitblickenden Freunden, manchmal
unter dem Druck der Zensur, manchmal, um dem Publikum, das durch
die Neuartigkeit des Werkes zunächst überfordert war, den Zugang
zu erleichtern.
Von Mussorgskis Boris Godunow gibt es nicht nur mehrere
szenische Versionen - einmal mit den Polen-Bildern, einmal ohne
sie, einmal ohne die Szene auf dem Platz vor der
Basilius-Kathedrale, einmal mit ihr, einmal mit dem Tod des
Boris als Stückschluss, dann wieder mit der Revolutionsszene bei
Kromy, wobei bis heute alle Varianten auf verschiedene Weise
miteinander kombiniert werden -, es existieren auch mehrere
musikalische Fassungen: die glättende und teilweise entstellende
Bearbeitung Rimski-Korsakows, des großen Freundes und Förderers
Mussorgskis, die Neu-Instrumentierung von Schostakowitsch, die
eine Annäherung an Mussorgskis Tonsprache anstrebt, und die
Originalpartitur, und natürlich kann man nur, wenn diese zur
Aufführung gelangt, von Werktreue sprechen. Aber ohne
Rimski-Korsakows - aus heutiger Sicht anfechtbarer -
Bearbeitung hätte sich Mussorgskis Oper kaum durchsetzen können,
denn erst in den letzten 30 bis 40 Jahren hat man die Vorzüge
der - im Vergleich zu den Bearbeitungen - spröden und rauhen
Originalinstrumentierung schätzen gelernt. Das bedeutet, dass
das Prinzip der Werktreue, hätte man von Anfang an danach
gehandelt, einer Verbreitung dieses Werkes im Wege gestanden
wäre.

Weitere
Verwirrung tritt bei der Frage auf, ob man das Werk kürzen darf.
Im Grunde müsste man jeden Strich, also die Weglassung von
Szenen, einzelnen Musiknummern oder auch nur von wenigen Takten,
als einen Verstoß gegen die Werktreue bezeichnen, falls er nicht
vom Komponisten ausdrücklich autorisiert ist. Und selbst dann
ist zu prüfen, ob der Komponist nicht nur im Hinblick auf ganz
spezifische Aufführungsbedingungen oder aus Rücksicht gegenüber
ganz bestimmten Sängern seine Einwilligung zu Kürzungen gegeben
hat, also aus rein pragmatischen Gründen, die unter anderen
Voraussetzungen entfallen.
Verdi schrieb im Dezember 1882 an seinen Freund Giuseppe Piroli:
„...Ich arbeite, aber ich arbeite an etwas beinahe Nutzlosem.
Ich reduziere den Don Carlos für Wien auf vier Akte. In
dieser Stadt schließen nämlich die Hausmeister um zehn Uhr
abends die Haupttore zu, und alles isst und trinkt...Folglich
muss das Theater bzw. die Vorstellung bis dahin aus sein. Zu
lange Opern werden grausam amputiert...Da man mir die Beine
abschneiden wollte, habe ich vorgezogen, das Messer selber zu
wetzen und anzusetzen.“
Solche Gründe gibt es heute natürlich nicht mehr. Aber ist dem
Werk gedient, wenn es dadurch, dass es ungekürzt dargeboten
wird, Langeweile aufkommen lässt? Selbst ein so wunderbares
Meisterwerk wie der Rosenkavalier weist schwächere
Stellen auf, und die eine oder andere wird bei fast jeder
Aufführung weggelassen.
Die Entscheidung darüber, ob und an welchen Stellen sich eine
Kürzung empfiehlt, kann von Interpretation zu Interpretation
unterschiedlich ausfallen, je nach subjektiver Ansicht des
Dirigenten bzw. Regisseurs.
Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass nämlich nicht
weniger, sondern mehr Musik gespielt wird, als der Komponist
wollte. Als sich bei den Proben zur Wiener Erstaufführung des
Don Giovanni herausstellte, dass der Sänger des Ottavio, der
Tenor Francesco Morella, seine für die Prager Uraufführung
geschriebene Arie „Il mio tesoro intanto“ nicht bewältigte, ließ
Mozart sie einfach weg und komponierte eine andere ohne
Koloraturen, die er statt im zweiten im ersten Akt platzierte: „Dalla
sua pace“. Zu Mozarts Lebzeiten erklangen nie zwei Ottavio-Arien
in einer Vorstellung. Versündigt man sich an der Werktreue, wenn
man, wie es oft geschieht, dennoch beide Arien singen lässt?
Und wie
verhält es sich mit den Übersetzungen fremdsprachiger Werke?
Ist es noch mit dem Begriff der Werktreue vereinbar, wenn der
Komposition, die sich schließlich an ganz bestimmten Worten
entzündet hat, ein Text in einer anderen Sprache unterlegt wird,
und sei er dem Original noch so nahe? Jede Übersetzung ist ein
Eingriff in die Substanz des Werkes. Aber nützt man ihm auf der
anderen Seite, wenn man es von Sängern singen lässt, die die
Sprache nicht beherrschen und vor einem Publikum spielt, das
kein Wort versteht, an dessen Ohren nur unverständliche Laute
vorbeiplätschern?
Wie sinnvoll ist es noch, wenn, wie z.B. an der Deutschen (!)
Oper am Rhein geschehen, eine Janacek-Oper in der tschechischen
Originalsprache aufgeführt wird, vorwiegend mit amerikanischen
und japanischen Sängern, so dass tschechische Besucher sich
nachher interessiert erkundigten, in welcher Sprache man
eigentlich gesungen habe?
Gerade die größten Opernkomponisten waren darauf bedacht, dass
man ihren Texten folgen kann und dass sie daher in die jeweilige
Landessprache übersetzt werden.
Es war für Verdi eine Selbstverständlichkeit, für seinen Don
Carlos, da er in Paris uraufgeführt wurde, ein in
französischer Sprache geschriebenes Libretto zu vertonen, und
ebenso selbstverständlich war es für ihn, dieses Werk ins
Italienische übersetzen zu lassen, als es in seiner Heimat zur
Aufführung gelangte.
Die Pariser Fassung des Tannhäuser besteht nicht nur in
der Umarbeitung und Neu-Komposition mancher Teile, sondern nicht
zuletzt darin, dass diese Oper - unter maßgebender Mitwirkung
von Wagner selbst - ins Französische übersetzt wurde.
Die Grand Opéra in Paris wollte Verdis Otello in der
Originalsprache herausbringen. Der Komponist schrieb 1894 an den
Impresario:„Otello in der großen Oper in italienischer
Sprache? Das überrascht und erstaunt mich. Wenn man unbedingt
den Otello in der Opéra bringen will, muss man ihn,
glaube ich, ins Französische übersetzen.“
Der grandiose Librettist Da Ponte, dem Mozart seine drei
wunderbarsten Operntextbücher verdankt, schrieb: „In einem Land,
in dem die italienische Sprache unbekannt ist, wäre die
Übersetzung aller Werke ins Deutsche überaus nützlich. Für 200
Gulden jährlich fände sich ein guter Übersetzer. Diese Ausgabe
ist im Vergleich zu dem daraus zu ziehenden Nutzen überaus
geringfügig.“
Mozart hat
nur deshalb Libretti in italienischer Sprache vertont, weil an
den betreffenden Theatern italienische Operntruppen engagiert
waren. Er hatte sich z.B. sehnlichst gewünscht, sein für München
italienisch geschriebener Idomeneo möge in Wien in
deutscher Sprache aufgeführt werden.
Am 12. September 1781 schrieb er an seinen Vater: „…der Glucks
Iphigenie in das Deutsche übersetzt hat, ist ein
vortrefflicher Poet, und dem hätte ich recht gerne meine Oper
von München zum Übersetzen gegeben.“ In einem Brief an Prof.
Anton Klein in Mannheim aus dem Jahre 1785 beschwert er sich
bitter und voller Ironie über die „Directeurs“ der Theater:
„Wäre nur ein einziger Patriot mit am Brette, es sollte ein
anderes Gesicht bekommen! Doch da würde vielleicht das so schön
aufkeimende Nationaltheater zur Blüte gedeihen, und das wäre ja
ein ewiger Schandfleck für Deutschland, wenn wir Deutsche einmal
mit Ernst anfingen, deutsch zu denken, deutsch zu handeln,
deutsch zu reden und gar – deutsch zu singen!“
Die Frage, ob man dem Werk und seinem Schöpfer gegenüber treuer
ist, wenn man die Originalsprache oder wenn man eine – und
natürlich möglichst gute – Übersetzung verwendet, ist oft
schwierig zu beantworten und darf keineswegs generell, sondern
nach gewissenhafter Prüfung nur für den Einzelfall entschieden
werden, wobei diese Entscheidung letzten Endes wiederum nur
subjektiv sein kann. Es sollte sich aber niemand darauf berufen,
dass es im Interesse des Librettisten oder Komponisten sei, ihr
Werk in der Originalsprache aufzuführen.

Fast alle
deutschsprachigen Theater, selbst die kleinsten Provinzbühnen,
haben sich inzwischen Übertitelungsanlagen zugelegt. Das Thema
„Werktreue“ wird davon insofern berührt, als diese Möglichkeit
die Bereitwilligkeit erhöht, in der Originalsprache singen zu
lassen. Ist zu deren Gunsten entschieden worden, so liegt der
Vorteil der besseren Verständlichkeit szenischer Vorgänge, die
durch Übertitel ermöglicht wird, auf der Hand. Man sollte sich
aber sehr gut überlegen, ob eine solche Entscheidung angesichts
der Nachteile, die Übertitelungen mit sich bringen, auch
wirklich gerechtfertigt ist. Dass die Zuschauer in den ersten
Sitzreihen Genickstarre bekommen und die Sänger klagen, sie
sähen vom Publikum nur noch die Nasenlöcher, ist das geringste
Übel. Schwerer wiegt, dass - wenn es sich nicht gerade um eine
Arie aus einer Händel-Oper handelt, die höchstens aus acht sich
wiederholenden Zeilen besteht - , nur ein Bruchteil des
gesungenen Textes wiedergegeben werden kann, dass der Librettist
erbarmungslos kastriert wird und dass der Opernbesucher eine
simple „Digest“-Version vorgesetzt bekommt. Überdies erreicht
die verstümmelte Aussage den Zuschauer nur indirekt, nicht durch
den Mund des Sängers, sondern durch eine projizierte Schrift,
nicht durch etwas organisch-Lebendiges, sondern durch ein totes,
technisches Hilfsmittel. Es fehlt die Unmittelbarkeit der
Mitteilung. Pointen erscheinen fast nie zeitgleich, und es ist
für den Sänger äußerst irritierend, wenn das Publikum schon
lacht, bevor die witzige Bemerkung gefallen ist oder wenn die
Reaktion erst Sekunden später erfolgt.
Manche Pointen gehen völlig verloren. Wenn in Così fan tutte
Fiordiligi und Dorabella angstvoll fragen, ob ihre Liebsten tot
seien und Don Alfonso antwortet „Morti ...“, dann eine
Spannungspause macht, in der die Schwestern fast in Ohnmacht
fallen, um wieder aufzuatmen, wenn er fortfährt „...non son“,
dann bleibt bei einer Übertitelung das Amüsement des Publikums
darüber aus, weil es von vornherein den ganzen Satz „Tot sind
sie nicht“ liest.
Bei raschen Wortwechseln und bei Ensemblestellen muss sich der
Besucher den Kopf zerbrechen, wer gerade was singt. Aus der
Übertitelung ist es nicht ersichtlich. Darüber hinaus erweist
sich die wochenlange Arbeit des Regisseurs weitgehend als
vergebens. Dem Publikum entgehen szenische Vorgänge und
wesentliche Details, weil es auf die Schrift starrt und auch
dann nach oben blickt, wenn gar keine erscheint, aus Angst,
etwas zu versäumen.
Auch die Leistungen des Dirigenten und des Orchesters werden nur
vermindert wahrgenommen, da im Moment des Lesens die akustische
Aufnahmefähigkeit beeinträchtigt ist.
Manchen Regisseuren allerdings kommen Übertitelungen höchst
gelegen, weil sie ihnen die Möglichkeit bieten, in der
Projektion diejenigen Textstellen wegzulassen, zu denen ihre
Inszenierung im Widerspruch steht.
In Così fan tutte ist des Öfteren von „la spada“, dem
„Degen“, die Rede. Lässt man die Oper in einer
Autobahnraststätte spielen, in der man bestenfalls mit
Schaschlikspießen, nicht aber mit Degen hantiert, spart man
einfach die betreffende Übersetzung aus. Manchmal scheut man
selbst davor nicht zurück, den projizierten Text gegenüber dem
Original so zu verändern, dass er zum „Regie-Einfall“ passt.
Hier wird ein Betrug am Publikum verübt, der von kaum jemandem
entdeckt wird. Wer die Fremdsprache nicht beherrscht oder das
Libretto nicht ganz genau kennt, erliegt der arglistigen
Täuschung, es handle sich um eine wörtliche Übersetzung des
gesungenen Textes.
In den großen Opernhäusern sind „surtitles“ zu einem notwendigen
Übel geworden. Internationale Stars oder Sänger, die als solche
verkauft werden, würden jeden auslachen, der ihnen zumutete,
eine italienische Oper auf Deutsch zu singen. Man muss sich aber
darüber im Klaren sein, dass Übertitel immer nur schwache
Krücken sein können, mit deren Hilfe der Opernbesucher durch das
Werk humpelt. Theater, für die bei der Wahl zwischen den
grundsätzlichen Möglichkeiten, Originalsprache oder Übersetzung,
allein schon das Vorhandensein einer Übertitelungsanlage
ausschlaggebend ist, handeln fahrlässig.
Der
verzweifelte Ruf nach Werktreue erschallt oft auch dann, wenn
die Handlung in einer anderen Zeit gespielt wird, als man es
erwartet. Aber auch hier sollte man vorsichtig sein und nicht
voreilig Anklage erheben.
Mehr Opern als man denkt, weisen gar keine Zeitangabe auf, es
hat sich nur eine Gewohnheit herausgebildet, sie in einer
bestimmten Periode anzusiedeln. Und auch wenn der Autor die Zeit
der Handlung angegeben hat, ist damit nicht unbedingt gesagt,
dass dies seinem eigentlichen Willen entspricht.
Verdis Rigoletto enthält die Zeitangabe: 16. Jahrhundert.
Verdi wollte aber - wie auch Victor Hugo mit seinem Drama Le
roi s‘amuse, das der Oper zugrunde liegt - den
Machtmissbrauch der Herrschenden seiner Gegenwart anprangern,
musste jedoch, da das Werk die Zensur sonst niemals passiert
hätte, die Handlung in die Renaissance verlegen.
Bei einer ganzen Reihe von Werken, die unter Diktaturen oder
unter einem rigorosen Absolutismus entstanden, verhält es sich
ähnlich. Heute, da es bei uns keine Zensur mehr gibt, haben wir
keinen Grund, solche Zeitangaben sklavisch zu befolgen. Die
Werktreue besteht eher darin, der ursprünglichen Absicht des
Komponisten Rechnung zu tragen.
Auch in anderen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, eine
Zeitverschiebung vorzunehmen. Diese Maßnahme ist aber nur dann
zu verantworten, wenn sie der begründeten Überzeugung
entspringt, dass dem Werk damit gedient ist.

Leider ist es
eine törichte Mode geworden, Opern grundlos und willkürlich z.
B. in die Entstehungszeit oder in unsere Gegenwart zu verlegen,
und ich halte es für einen verhängnisvollen Irrtum zu glauben,
eine Inszenierung sei schon allein deswegen modern (was auch
immer das sein mag), weil die Sänger heutige Kleidung tragen.
Ein solches Verfahren ist übrigens alles andere als neu: im 17.
und 18. Jahrhundert war es durchaus üblich, griechische und
römische Opernfiguren nicht in historischen, sondern in Barock-
bzw. Rokoko-Kostümen auftreten zu lassen, sie also nach der
damals herrschenden Mode zu kleiden, so wie ja auch Maler der
damaligen Zeit biblische Szenen kostümlich in ihre Gegenwart
verlegten und als Hintergrund nicht historische Stätten, sondern
Ansichten ihrer Heimat wählten, wie z. B. an dem Gemälde „Der
bethlehemitische Kindermord“ von Pieter Bruegel dem Älteren gut
zu sehen ist.
Aber, so
könnte man einwenden, sollte man sich nicht wenigstens an die
Regiebemerkungen halten, die doch den erklärten Willen der
Schöpfer des Werkes hinsichtlich der szenischen Umsetzung
darstellen?
Nun, so sicher, wie es scheint, ist der Boden, auf dem wir uns
hier bewegen, auch nicht. Voraussetzung ist, dass solche
Regieanweisungen in der Partitur oder im Klavierauszug überhaupt
existieren. Bei Mozart-Opern z.B. sind kaum welche zu finden.
Dann muss man sich vergewissern, dass diese Anweisungen
tatsächlich von den Autoren und nicht etwa von den Herausgebern
oder Bearbeitern stammen, ob sie sich nicht aufgrund einer
Aufführungspraxis nach und nach eingeschlichen haben. Und das
ist nicht immer so klar ersichtlich wie z.B. in der
Peters-Ausgabe der Tristan-Partitur, in der die nicht von
Wagner, sondern von Felix Mottl stammenden Angaben deutlich
gekennzeichnet sind.
Und schließlich hat man gründlich zu prüfen, um was für eine Art
von Anweisungen es sich handelt. Ich möchte sie in drei
Kategorien einteilen: solche, die man buchstabengetreu
verwirklichen muss, weil damit eine wesentliche Aussage über den
Charakter der Figur oder das Typische einer Situation gemacht
wird, solche, deren Sinn man gerecht werden sollte, was aber
auch durch völlig andere szenische Lösungen möglich ist, und
solche, die man einfach nicht befolgen darf, weil sie so zeit-
und geschmacksgebunden sind, dass ihre Realisation einer
heutigen Aufführung nur schaden würde.
Gute Beispiele für diese drei Kategorien finden sich in Wagners
Tannhäuser.
Im 2. Akt, bei dem Sängerwettstreit auf der Wartburg, schreibt
Wagner nach dem Vortrag Tannhäusers: „Elisabeth macht eine
Bewegung, ihren Beifall zu bezeugen, da aber alles in ernstem
Schweigen verharrt, hält sie sich scheu zurück.“ Um die
Bedeutung dieser Anweisung zu ermessen, muss man sich die
Situation vergegenwärtigen: Wolfram von Eschenbach hatte die
Liebe mit einem Wunderbronnen verglichen, den man nicht
berühren, sondern nur aus der Ferne anbeten darf.
Daraufhin erwidert Tannhäuser:
Doch ohne
Sehnsucht heiß zu fühlen,
ich seinem Quell
nicht nahen kann;
des Durstes
Brennen muss ich kühlen,
getrost leg ich
die Lippen an.
In vollen Zügen
trink ich Wonnen,
in die kein Zagen
je sich mischt,
denn unversiegbar
ist der Bronnen,
wie mein Verlangen nie erlischt.
Die spontane
Zustimmung Elisabeths zu diesem Lobgesang auf die sinnliche
Liebe zeigt ihre ganze Wärme und Liebesbereitschaft, und auch
die kalte, verständnislose Haltung der verkrusteten
Wartburg-Gesellschaft wird durch diese Regiebemerkung
charakterisiert.
Eine solche Anweisung ist unbedingt zu befolgen. Wenn Wagner
dagegen bei Beginn des ersten Aktes schreibt: „Im äußersten
Vordergrunde links liegt Venus auf ihrem Lager ausgestreckt, vor
ihr halb kniend Tannhäuser, das Haupt in ihrem Schoße“, so
besteht keine Notwendigkeit, diese Anweisung genauso
auszuführen. Man sollte man sie aber nicht unbeachtet lassen.
Die Worte „das Haupt in ihrem Schoße“ enthalten eine Bedeutung,
die für die ganze Ausgangssituation von größter Wichtigkeit ist.
Wir haben es hier, wie oft bei Wagner, mit einem archetypischen
Bild zu tun. Der Schoß gehört zum urmütterlichen Bezirk, der
auch das Unbewusste repräsentiert. Wenn sich der Kopf
Tannhäusers, der selbstverständlich den Sitz des Bewusstseins
bedeutet, sich in diesem Schoß befindet, so ist sein Zustand ein
dem Schlaf und Traum analoger, gleichsam unbewusster. Wie man
diese Szene auch gestalten mag, man wird versuchen müssen, dem,
was Wagner mit dieser Anweisung zum Ausdruck bringt, zu
entsprechen.
Zu der dritten Kategorie, zu den Regiebemerkungen, die man
besser außer Acht lässt, gehört die Anweisung am Schluss des
ersten Aktes: „Das ganze Tal wimmelt jetzt von dem noch stärker
angewachsenen Jagdtross. Der Landgraf und die Sänger wenden sich
den Jägern zu. Der Landgraf stößt in sein Horn, lautes
Horngeschmetter und Rüdengebell antwortet ihm. Während der
Landgraf und die Sänger die Pferde, die ihnen von der Wartburg
zugeführt worden sind, besteigen, fällt der Vorhang.“
Wollte man diese Anweisung befolgen, so würde man das
Gesamtkunstwerk Wagners mit den Karl-May-Festspielen in Bad
Segeberg verwechseln. Für die Beurteilung aber, welche
Regieanweisung welcher Kategorie zuzuordnen ist, lassen sich
keine allgemein verbindlichen, objektiven Richtlinien
aufstellen, so dass wir auch hier wieder der subjektiven Meinung
des Nachschöpfers ausgeliefert sind.
Wesentlich
ist - und nun wollen wir versuchen, doch wieder etwas festen
Boden unter den Füßen zu gewinnen - , dass diese
unvermeidliche, ja notwendige Subjektivität als Verpflichtung
und nicht als Freibrief verstanden wird, d.h. dass sie darin
besteht, die eigenen (nach-)schöpferischen Kräfte in den Dienst
des Werkes zu stellen und nicht darin, sie wild wuchern und in
eine Selbstdarstellung münden zu lassen.
Nicht
unbedingt nachahmenswert erscheint mir z.B. die
Herangehensweise, wie sie in einem Interview von Katharina
Thalbach zum Ausdruck kommt.
Die FAZ kommentierte im November 2009: „Katharina Thalbach
inszeniert Oper… Diesmal: Rossinis Il barbiere di Siviglia.
Das wird ein Spaß! In der Monatsschrift der Deutschen Oper
Berlin erklärt sie uns, warum. Sie kennt das Stück nicht („etwas
total Neues“), freut sich aber riesig, es bei den Proben kennen
zu lernen. Sie kann keine Partitur lesen („versuche natürlich,
über den Dirigenten etwas herauszubekommen“), sie kann kein
Italienisch („hoffe aber, dass ich genug Leute um mich habe, die
des Italienischen sehr mächtig sind, dass wir vielleicht damit
doch noch ein bisschen herumspielen können“), …noch hat sie
überhaupt irgendeine Ahnung („ich scheue mich, allzu viel vorher
zu wissen“).
Frage: Würden Sie zu einem Friseur gehen, der sich total auf
Ihren Kopf freut, aber weder Kamm noch Schere kennt und hofft,
dass genug Leute im Laden herumstehen, die ihm sagen, wie
Haareschneiden geht? Premiere ist am 29. November, wir schicken
natürlich wieder unseren blinden Kritikerkollegen hin, der etwas
schwerhörig ist und nicht schreiben kann.“
Der Weg, der
mir der richtige zu sein scheint, ist mit Schwierigkeiten
gepflastert. Wenn man ihn beschreitet, muss man zunächst die
Frage stellen: was haben die Autoren, Komponist und Librettist,
mit ihrem Werk gewollt? Glaubt man, die Antwort gefunden zu
haben, muss sich man weiter fragen: wie kann ich den Willen der
Autoren dem Publikum, dem heutigen Publikum verständlich machen,
und wie kann ich es mit den Mitteln, die mir im konkreten Fall
zur Verfügung stehen?
Dies sind die Grundfragen, die eine Unzahl weiterer Fragen in
sich bergen.
Die
Erfindungskraft muss sich am Werk entzünden. Es ist nicht
notwendig, die Grenzen, die durch das Werk selbst gezogen sind,
zu überschreiten. Es gibt innerhalb dieser Grenzen noch
unendlich viel zu entdecken, es liegen noch reiche Schätze
verborgen, und jede Zeit kann sich das entnehmen, was ihr
wertvoll erscheint.
Ich darf an das Goethe-Wort erinnern: „Willst du ins Unendliche
schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten!“, und es wäre
hier zu ergänzen: auch in die Tiefe.

Ich halte es für einen Missbrauch des Werkes, von
außen Tendenzen hineinzutragen, ihm Ideologien aufzupfropfen,
die ihm fremd sind. Wem es um eine bestimmte Aussage geht, der
soll sich das Werk suchen, das diese Botschaft enthält, und wenn
er es nicht findet, dann soll er es sich selber schreiben.
Und wem es nur um Selbstverwirklichung zu tun ist, der suche
sich ein anderes Medium.
Das Theater ist keine therapeutische
Anstalt zur Heilung spätpubertärer Krankheitserscheinungen von
Regisseuren. Der Opernbesucher, der sich eine Eintrittskarte für
eine Don Giovanni-Vorstellung kauft, hat ein Recht
darauf, in irgendeiner Weise mit Mozart und Da Ponte
konfrontiert zu werden und bezahlt nicht, um sich mit den
Schwierigkeiten auseinander zu setzen, die der Regisseur auf dem
Gebiet der Sexualität hat.
Die
Neigung mancher Regisseure, sich selbst wichtiger zu nehmen als
den Autor und sein Werk, kann man nicht erst in unserer Zeit
beobachten. Schon 1931 sah sich Arnold Schönberg veranlasst, an
Anton Webern zu schreiben: „Ich wollte den neuen Beherrschern
der Theaterkunst, den Regisseuren, möglichst wenig überlassen
und auch die Choreographie soweit erdenken, als es nur möglich
ist. Denn all das liegt heute sehr im Argen, und die
Eigenmächtigkeit der Hilfsorgane und ihre Gewissenlosigkeit
werden nur noch von ihrer Kulturlosigkeit und Impotenz
übertroffen.“
Im Jahre 1948 mahnte Gustav Gründgens in einer Rede vor dem
Deutschen Bühnenverein, dessen Präsident er damals war:
„Der größte Feind einer neuen
Theaterentwicklung ist unsere Originalitätssucht: der Wunsch,
neu zu sein um jeden Preis; auch um den Preis des Werkes, das
wir zu interpretieren hätten. – Unsere Arbeit ist nicht dann
schöpferisch, wenn wir eine Dichtung nehmen und uns mit ihr in
Szene setzen, sondern unser Beruf beginnt dann schöpferisch zu
werden, wenn es gelingt, vom Dichter Geschautes und Gewolltes in
einer Aufführung zu verdeutlichen oder gar zu steigern.“
„Vom Dichter“
- und ich darf erweitern: vom Komponisten - „Geschautes und
Gewolltes zu verdeutlichen oder gar zu steigern“: diese
Forderung wird in zunehmenden Maße vernachlässigt oder
missachtet.
Um sich zu rechtfertigen, versuchen Regisseure, ihre Elaborate
mit verschiedenen Thesen theoretisch zu untermauern.
Lassen Sie mich drei davon herausgreifen!
Erstens: was man in der Musik hört, brauche man nicht zu sehen,
ja, dürfe man gar nicht sehen, da sonst eine Tautologie
entstünde und die Wirkung sich aufhebe. So genüge es z.B. zu
Beginn von Verdis Otello, wenn nur das Orchester den
wütenden Meeressturm, das Peitschen der Wogen, das Krachen der
Blitze schildert und der Chor seiner Angst vor den Elementen,
seinem Bangen um das in Seenot geratene Schiff und seinem Jubel
über die Errettung rein musikalisch Ausdruck verleiht, man könne
sich eine optische Entsprechung ersparen, es sei z.B. viel
origineller, wenn der Chor in Frack und Abendkleid hinter
Notenpulten in einem Bühnenbild steht, das einem Schuhkarton
gleicht (sehr beliebt !), und regungslos vor sich hin singt. So
müsse man z.B. zu der unendlichen Weite und Einsamkeit, die die
Einleitung zum dritten Akt des Tristan suggeriert, diesem
Hauch von Ewigkeit, der uns in dieser Musik entgegenweht, im
Bühnenbild einen Kontrast schaffen, am besten eine möglichst
enge Zelle einer Irrenanstalt zeigen. Man müsse eine Irritation
zwischen Akustik und Optik erzeugen, was dann oft auch großartig
gelingt: das Publikum, falls es nicht schon nach kurzer Zeit die
Augen schließt (was eigentlich nicht im Sinne des Regisseurs
sein sollte), gerät in einen Zwiespalt, der Verärgerung und
Aggression auslöst. Ist es das, was die Autoren mit der
Schaffung ihres Werkes erreichen wollten?

Die zweite
These geht noch einen Schritt weiter: was die Worte besagen,
brauche man nicht mehr zu zeigen. Wenn z.B. in Alban Bergs
Lulu der alte Schigolch die Teppiche in Lulus Zimmer
bewundert und Lulu glücklich demonstriert „Ich geh so gerne
barfuß drauf“, dann brauche man gar keine Teppiche auf der
Bühne, sie seien ja schon erwähnt worden. Es genüge, wenn Rocco
in der Kerkerszene des Fidelio zu Leonore singt „Komm
hilf doch diesen Stein mir heben“, zeigen brauche man diesen
Stein nicht auch noch, und es sei auch nicht notwendig, dass
Florestan Fesseln trägt, es würde ja oft genug davon gesungen.
Hier ist der Glaubwürdigkeit der Vorgänge endgültig der Boden
entzogen, und auch die Figuren werden unglaubwürdig, da das, was
sie äußern, als Unsinn erscheint. Man hat manchmal den Eindruck,
auf der Bühne Schwachsinnige vor sich zu haben, die an
Realitätsverlust leiden. Alles wird beliebig, und man könnte
glauben, nicht einer Inszenierung, sondern einem Happening
beizuwohnen, hätte der Wahnsinn nicht Methode und wäre meist
minutiös einstudiert. Wenn man weiß, wie leidenschaftlich und
manchmal verzweifelt gerade die bedeutendsten Opernkomponisten
um jedes Wort gerungen haben, wie viel einem Richard Wagner, dem
späteren Verdi, einem Puccini, einem Richard Strauss das Wort,
das ihnen zur musikalischen Inspiration wurde, der durch die
Worte bezeichnete Vorgang und seine szenische Umsetzung
bedeuteten, dann kann man ermessen, was für ein Frevel an dem
Werk und seinem Autor durch eine solche Vorgehensweise verübt
wird.

Die dritte
These enthält die Forderung, die Rezeptionsgeschichte des Werkes
müsse mitinszeniert werden, das Wichtigste seien die
gesellschaftlichen und politischen Vorgänge, von denen das Werk
seit seiner Entstehung betroffen war. Typisch für diese
Einstellung ist z.B. der Vorwurf, den ein Kritiker der
Zeitschrift „Opernwelt“ einer Inszenierung von Wagners Oper
Die Meistersinger von Nürnberg machte: „Die
Wirkungsgeschichte des Werkes bleibt außen vor: nicht der
kleinste Seitenblick auf ideologische und historische
Vereinnahmungen des Stückes.“ Warum aber muss man in einer
Inszenierung dieses Werkes die Tatsache berücksichtigen, dass es
- aufgrund eines fundamentalen Missverständnisses - die
Lieblingsoper der Nationalsozialisten war? Was kann der deutsche
Schäferhund dafür, dass Adolf Hitler eine Vorliebe für diese
Rasse hatte? Thomas Mann, der ja wohl über den Verdacht erhaben
ist, einen rechtsgerichteten Chauvinismus zu vertreten, brachte
es auf den Punkt: „Es ist durch und durch unerlaubt, Wagners
nationalistischen Gesten und Anreden den heutigen Sinn zu
unterlegen – denjenigen, den sie heute hätten. Das heißt sie
verfälschen und missbrauchen, ihre romantische Reinheit
beflecken. Die nationale Idee stand damals, als Wagner sie…in
sein Werk einfließen ließ, in ihrer heroischen, geschichtlich
legitimen Epoche.“ Dem Konzept muss die Absicht zugrunde liegen,
in der ein Werk geschrieben wurde, und nicht die Wirkung, die es
aufgrund von Fehlinterpretationen nach sich gezogen hat.

Genau so
abwegig ist z.B. die Meinung, man dürfe dem optimistischen,
versöhnlichen Schluss der Zauberflöte nicht trauen, man
müsse ihn ins Negative umdeuten, da man heute wisse, dass Mann
und Weib und Weib und Mann nicht an die Gottheit heranreichen,
dass die Großen dieser Welt nicht auf dem Pfad der Tugend und
Gerechtigkeit wandeln und dass aus der Erde kein Himmelreich
geworden ist. Ähnlich absurd ist die Ansicht, man müsse das
Jubelfinale des Fidelio umfunktionieren und zeigen, dass
politische Gefangenschaft, Folter und Mord nach wie vor an der
Tagesordnung sind, dass die Befreiung der Menschheit nicht
gelungen ist. Wie anmaßend und überheblich kann man denn noch
sein, dass man glaubt, Mozart und Beethoven korrigieren und
belehren zu müssen? Als ob diese und manche andere Komponisten
nicht schon damals die Inhumanität unserer Welt klar erkannt
hätten! Das war für sie ja der Anlass, Gegenbilder zu schaffen.
Gerade weil sie eine Welt vor Augen hatten, in der immer noch
Tyrannei und Unterdrückung geistiger Freiheit herrschten,
zeigten sie die Erreichung eines Idealzustandes, gerade weil sie
sich der Realität schmerzlich bewusst waren, entwarfen sie eine
Utopie. Sicher gibt es Werke, in denen es sich der Autor zur
Aufgabe gemacht hat, der Welt einen Spiegel vorzuhalten, sie so
zu zeigen, wie sie ist. Es gibt aber auch Werke, die die Welt so
zeigen, wie sie sein sollte. Wer diese Tatsache nicht erkennen
kann oder will, sollte einen Fidelio nicht inszenieren.

Ich habe
eingangs die Opernpartitur mit einem Skelett verglichen, aus dem
die Interpreten ein Wesen aus Fleisch und Blut zu machen haben
und das sie, wenn ein lebendiger Körper entstanden ist, kleiden
müssen.
Nun gibt es Regisseure, die auf genialische Art einen
schnittigen, modischen Anzug entwerfen, ohne eine Ahnung zu
haben, wie der Körper beschaffen ist, ohne sich die Mühe gemacht
zu haben, zunächst einmal den Knochenbau kennen zu lernen.
Natürlich wird der Anzug nicht passen, aber das ist ja kein
Problem: man schneidet hier ein Stück Fleisch weg und fügt dort
eine Plastik hinzu, und wenn es dazu beiträgt, dass der schöne
Anzug noch besser zur Geltung kommt, nimmt man auch schon einmal
eine Amputation vor oder setzt eine Prothese ein; ein Verfahren,
das oft zu großem Erfolg führt. Ein Teil des Publikums lässt
sich von dem interessanten und, ach, so modernen Habitus blenden
und sieht nicht, dass der Körper verunstaltet und das Skelett
verkrüppelt ist, und so kommt es dazu, dass man das Werk für
minderwertig hält, hingegen bewundert, was die Regie doch noch
daraus gemacht hat.
Dabei ist
eine ganz erstaunliche gegenläufige Entwicklung zu beobachten,
was den musikalischen und was den szenischen Bereich betrifft.
Noch nie in der Musikgeschichte gab es so starke Bestrebungen,
das ursprüngliche Notenbild wiederherzustellen und die
Partituren möglichst originalgetreu, zum Teil unter Verwendung
historischer Instrumente, so erklingen zu lassen, wie sie
vermutlich zur Zeit ihrer Entstehung gespielt wurden.
Wenn die Ergebnisse auch oft unterschiedlich und letzten Endes
nur hypothetisch sind, so besteht doch eine unverkennbare
Tendenz, sich dem musikalischen Willen des Komponisten und
seiner klanglichen Vorstellung so weit wie möglich anzunähern.

Ganz im
Gegensatz dazu steht der modische Trend bei der szenischen
Realisation. Die Werke werden als Steinbruch verwendet, werden
zerschlagen, und die Trümmer dienen als Material für neue
Gebilde, die nichts mehr mit der Vision des Komponisten zu tun
haben, sondern von den seltsam verknoteten Gehirnwindungen der
Regisseure bestimmt werden.
Erstaunlich ist aber nicht nur dieses Auseinanderdriften der
Vorgehensweisen bei der musikalischen und der szenischen
Umsetzung, es ist auch höchst verwunderlich, dass dieselben
Dirigenten, die mit missionarischem Eifer die Werktreue ihrer
Interpretation verkünden, gegenüber den Vorgängen auf der Bühne
völlig gleichgültig sind, auch wenn diese den Intentionen des
Komponisten offensichtlich zuwiderlaufen und die Wirkung der
Musik schädigen.
So schrieb der berühmte Musikkritiker Joachim Kaiser in der
„Süddeutschen Zeitung“: „Wenigstens ein harmloses Beispiel für
gewisse Aktualisierungs-Absurditäten: in Mozarts Heimat Salzburg
begann bei den Sommer-Festspielen des Jahres 2003 der Titus,
eine strenge Seria-Oper aus dem letzten Lebensjahr des
Komponisten, nicht mit der glänzenden Ouvertüre. Sondern:
nachdem es dunkel geworden war und jeder sich gespannt freute
auf den festlichen Ton von Mozarts, heller als tausend Sonnen
leuchtendem Einstimmungs-C-Dur, erblickten wir eine (sich später
als der Kaiser Titus erweisende) Figur, die nervös zu
telefonieren suchte. Endlich, von mancherlei Aktionen versehrt,
durfte auch die Ouvertüre erklingen. Dass ein Regisseur, auf
Modernisierung erpicht und dem Geist der Musik gegenüber
grenzenlos gleichgültig, im Stande ist, einen solchen Anfang zu
ersinnen, lässt sich einsehen. Aber dass Nicolaus Harnoncourt,
der große Mozart-Kenner und Opera-seria-Dirigent, dabei mittut,
schien wahrhaft schlimm.“
An dem
Verlust der Maßstäbe für Werk und Interpretation sind die
Feuilletonisten nicht ganz unschuldig. So mancher Kritiker, der
ein Werk schon so oft gesehen und rezensiert hat, dass er gar
nicht mehr weiß, was er schreiben soll (was in Programmheften
oder in der Sekundärliteratur nachzulesen ist, hat er längst
alles abgeschrieben), begrüßt freudig jede neue Variante, und
sei sie noch so widersinnig. Er vergisst, dass es sich für viele
Besucher um die erste Begegnung mit dem Werk handelt und dass
neue Generationen heranwachsen, die ein Recht darauf haben, mit
dem Werk selbst konfrontiert zu werden und nicht mit der zehnten
oder fünfzehnten Variation, in der das Thema nicht mehr
erkennbar ist. Manche Inszenierungen können so abstrus sein wie
sie wollen, es findet sich garantiert ein Rezensent, der das,
was auf der Bühne stattfindet – oder auch nicht stattfindet –
für genial hält.
Aber das kennen wir ja zur Genüge: wenn einem Regisseur in
seiner absoluten Hilflosigkeit nichts mehr einfällt, wenn er
z.B. vor dem Liebesduett im zweiten Akt des Tristan
kapituliert und Isolde ganz rechts und Tristan ganz links an die
Rampe stellt – oder umgekehrt – und sie frontal ins Publikum
singen lässt, dann können wir in der Rezension lesen, wie
wunderbar der Regisseur die tragische Beziehungslosigkeit dieser
Figuren, die erschütternde Vereinsamung der Seelen zum Ausdruck
gebracht habe.

Die Presse
hat einiges dazu beigetragen, dass so mancher Opernbesucher
verunsichert wurde und Minderwertigkeitsgefühle entwickelte.
Wenn er den Vorgängen auf der Bühne nicht mehr zu folgen vermag
oder nicht zu folgen gewillt ist, wird er einfach als altmodisch
und zu konservativ hingestellt. Sicher gibt es ab und zu
Aufführungen, die so überraschend und neuartig sind, dass das
Publikum ihre Qualität erst nach einer gewissen Zeit zu schätzen
weiß.
Man denke nur an die eine oder andere bahnbrechende Bayreuther
Inszenierung Wieland Wagners! Aber das sind Ausnahmen. In der
Regel richtet sich der Protest dagegen, dass eine Inszenierung
antimusikalisch, sinnentstellend, geisttötend oder in sich
selbst widersprüchlich ist.
Die ausgebuhten Theatermacher verstehen sich als Opfer eines
bornierten, reaktionären Publikums, sofern sie das Buhkonzert
nicht vorsätzlich provozieren, um wenigstens auf diesem Wege
Aufmerksamkeit zu erregen.
Mit
Redewendungen wie
„gegen den Strich bürsten“,
„hinterfragen“,
„gegen Publikumserwartungen angehen“,
„Denkanstöße geben“,
„Brüche aufzeigen“,
um nur einige Beispiele aus dem Phrasenkatalog für Kritiker zu
zitieren, verschleiert man nur allzu oft die eigene Unsicherheit
in der Beurteilung.
Begriffe werden missbraucht, Aufführungen, die sich am Werk
orientieren, als konventionell abqualifiziert, solche, die es
vergewaltigen, als innovativ gepriesen, es wird als modern
ausgegeben, was in Wirklichkeit nichts als modisch ist.
Wenn während der Aufführung die Zuschauer Türe knallend den Saal
verlassen, spricht man von „lebendiger Auseinandersetzung“, wenn
die Besucherzahlen und Einnahmen sich ständig verringern,
verkünden die Intendanten, dass bei ihnen eben anspruchsvolles,
richtungsweisendes Theater gemacht werde, für das das
rückständige Publikum erst noch reif werden müsse.
Um dieser Begriffsverwirrung und Begriffsverdrehung zu entgehen,
genügt eine einzige Unterscheidung: die in gutes und schlechtes
Theater. Theater ist gut, wenn es die Werke so darstellt, dass
das Publikum in die Lage versetzt wird, ihre Werte zu erkennen
und sich daran rational und emotional zu bereichern. Theater,
das diesen Anspruch nicht erfüllt, ist schlecht.

Nach allen
diesen Ausführungen möchte ich - und das scheint mir sehr
wichtig - in Erinnerung rufen, was ich zu Beginn über die
Schwierigkeit gesagt habe, ein Werk wirklich zu kennen.
Mangelhafte Kenntnis oder gar Unkenntnis des Werkes können auf
Seiten des Publikums dazu führen, dass eine Inszenierung
abgelehnt wird, obwohl sie dem Willen der Autoren im Grunde
gerecht wird, nur vielleicht in einer neuartigen, ungewohnten
Form. Mangelhafte Kenntnis oder Unkenntnis des Werkes auf Seiten
der Interpreten kann dazu führen, dass diese nicht mehr auf
seinem Boden stehen, sich von ihm entfernen und auf Irrwege
geraten.

Lassen
Sie mich zum Abschluss einen Autor zitieren, dem sicher niemand
nachsagen wird, konservativ oder reaktionär gewesen zu sein:
Bertold Brecht.
Was er über die Aufführung klassischer
Werke sagt, lässt sich auf Theaterproduktionen im Allgemeinen
übertragen: „Der lebendigen Aufführung unserer klassischen Werke
steht viel im Wege. Das Schlimmste ist die Denk- und
Fühlfaulheit der Routiniers. Es gibt eine Tradition der
Aufführung, die gedankenlos zum kulturellen Erbe gezählt wird,
obwohl sie das Werk, das eigentliche Erbe, nur schädigt: das ist
eigentlich eine Tradition der Schädigung der klassischen Werke.
Es fällt sozusagen durch Vernachlässigung mehr und mehr Staub
auf die alten großen Bilder, und die Kopisten kopieren mehr oder
minder fleißig diese Staubflecken mit. Hauptsächlich verloren
geht dabei die ursprüngliche Frische der klassischen Werke, ihr
damalig Überraschendes, Neues, Produktives, das ein Hauptmerkmal
dieser Werke ist… Natürlich entsteht dadurch mit der Zeit eine
schreckliche Langeweile, die den Klassikern ebenfalls ganz fremd
ist. Dagegen nun richten sich die Bestrebungen oft talentierter
Regisseure, neue, bisher nicht gesehene, sensationelle Effekte
auszudenken, die jedoch rein formalistischer Art sind, das heißt
dem Werk, seinem Inhalt und seiner Tendenz aufgesetzt und
aufgedrängt werden, so dass es zu sogar noch schlimmeren
Schädigungen kommt als bei traditionsgebundenen Aufführungen;
denn hierbei werden Inhalt und Tendenz des klassischen Werkes
nicht nur verdunkelt oder verflacht, sondern direkt verfälscht.
– Wir müssen das Werk neu sehen, wir dürfen uns nicht an die
gewohnheitsdiktierte Art halten. Und wir dürfen nicht rein
formale, äußere, dem Werk fremde ‚Neuerungen‘ anstreben. Wir
müssen den ursprünglichen Ideengehalt des Werkes herausbringen.“

Insofern gibt
es wohl doch eine Werktreue, die aber nicht im Befolgen des
Buchstabens, sondern im Aufspüren des Geistes besteht. Und es
gibt eine Werk-Untreue, die zur Beschädigung und Zerstörung des
Werkes führen kann.
Zitatende
Quelle:
Vortrag von Peter Brenner-Felsenstein – vorm. Intendant in
Darmstadt und in Mainz
|

Bildung oder nur
Wissen?
|
|
|
Zitat
Zwischen
Goethe und Google
Was ist
Bildung?
Allgemeinbildung
und der schnelle Klick bei Google müssen einander nicht
ausschließen. Vermutlich lässt sich in der Schule beides
miteinander verbinden.
Bildung ist der Schlüssel zur Welt, heißt es. Aber was bedeutet
Bildung in Zeiten von Google, Alexa & Co? Welches Wissen
brauchen wir, um die Welt zu verstehen – und wie sollte ein
zukunftsfähiges Bildungssystem aussehen? Diskutieren Sie mit!
„Bildung ist unsere gelebte
Neugier und nicht etwa unsere Zurichtung für eine Karriere oder
für eine Verwendbarkeit auf dem Arbeitsmarkt“, sagt
Stephan A. Jansen, Professor für Management, Innovation &
Finanzen an der Karlshochschule in Karlsruhe.
In Zeiten der Digitalisierung
sei es wichtiger denn je, andere Wege einzuschlagen. Der alte
Kanon habe ausgedient: „Belohnt wird nicht das Selbstdenken,
sondernd das Repetieren von bereits anderweitig Gedachtem,
Erkanntem, Aufgeschriebenem.“
Aus Lehranstalten werden Anregungsarenen
Sein Gegenentwurf: „Bildung ist
Stolpern, sich Fangen, sich Weiterbewegen.“ Den Bildungskanon
könnten auch Alexa und Siri verwalten, Wissen sei weltweit mit
ein paar Klicks verfügbar. Lehranstalten seien out, Schulen und
Universitäten sollten „Anregungsarenen“ sein. Seine Auffassung
skizziert der Wirtschaftswissenschaftler in seinem Buch
„Die Befreiung der Bildung“.
„Bildung funktioniert nur über
konkrete Inhalte“, sagt
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des
Deutschen Philologenverbandes. Der Verband vertritt 90.000
Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien, Gesamtschulen, Hochschulen
sowie an anderen Bildungseinrichtungen, die auf das Abitur
vorbereiten. „Ich kann mich nicht über mich allein definieren,
ich muss mich über irgendetwas definieren, in der
Auseinandersetzung mit etwas. Das darf nicht beliebig sein.“
„Wir brauchen vertiefte Allgemeinbildung“
Man müsse sich schon auf einen
gemeinsamen Kanon verständigen, so die ehemalige Lehrerin und
beurlaubte Professorin für Schulpädagogik an der
Philips-Universität Marburg. „Wir brauchen Wissen, vertiefte
Allgemeinbildung, um sicher und kompetent einschätzen zu können,
was Google und Alexa uns anbieten. Natürlich habe auch ich ein
Smartphone, aber ich habe die Kompetenz, um stutzig zu sein,
wenn wir jemand etwas Idiotisches erzählen will.“
Der Reiz von Google und anderen
Diensten bestehe darin, dass sie jederzeit und an jedem Ort
verfügbar seien. „Schule muss das Gegenteil sein: Ruhe,
Gründlichkeit, Vertiefung. Bildung ist immer auch
Selbstreflektion. Und das kann mir kein Gerät abnehmen.“
(sus)
Zitatende
Quelle:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zwischen-goethe-und-google-was-ist-bildung.970.de.html?dram:article_id=470307 |


Was andere schrieben
|
|
|
Zitat
„Follies”
Dresden, Staatsoperette: Ein
Tanzensemble, dreißig Jahre - und viele geteilte Erinnerungen.
Kurz gesagt sind das die Fäden, aus denen Stephen Sondheim und
James Goldman 1971 ihr Musical „Follies" strickten. Das Stück
ist in mehrfacher Hinsicht revolutionär für das Genre: Mehr Show
als Theater verbindet es die famose und vielschichtige Musik
Sondheims mit einem teils düster-bitteren Figurenpsychogramm...
Regisseur Martin G. Berger hat das zuletzt 1991 in Deutschland
gespielte Werk für die Staatsoperette Dresden ins Deutsche
übertragen und zeigt es im Kraftwerk Mitte auch als Replik an
die Geschichte des Hauses. Hier sieht man die vier Protagonisten
des Abends zunächst via Videoprojektion (Vincent Stefan) vor der
alten Spielstätte in Dresden-Leuben stehen, wo sie ihre
Zeitreise in die Vergangenheit antreten.
Diese inszeniert Berger mit
allerhand Sinneszauber... Der Zauber wirkt auch an der
Staatsoperette sofort: Sondheims großartige Musik lässt manche
Länge im Text vergessen...
Nein, musikalisch wie
darstellerisch bleiben hier wirklich keine Wünsche offen. Das
Orchester und das Ensemble der Staatsoperette Dresden bescheren
mit ihrem inspirierten, mitreißenden Spiel viele prickelnde
Momente. Zu verdanken ist das auch der Musik, denn Dirigent
Peter Christian Feigel kann bei Sondheims zwar leichtfüßigen,
aber nie simplen Kompositionen stets aus dem Vollen schöpfen...
Besonders im zweiten Teil jedoch offenbaren sich Brüche in der
Stückkonzeption... Regisseur Martin G. Berger rettet sich mit
Humor und Unterhaltungseffekten, was funktioniert, aber zugleich
irritiert...
NICOLE CZERWINKA - DRESDNER
NEUESTE NACHRICHTEN - 04.11.2019
Zitatende |

|
|
|
Zitat
„SAMSON ET DALILA”
Berlin, Staatsoper: Die Philister
sind überall und saugen sich mit ihren Sitzorganen fest in
dieser Welt... Bei der Premiere von „Samson et Dalila" an der
Berliner Staatsoper Unter den Linden sind natürlich viele
Philister im biblischen Sinne, also die vorchristlichen Feinde
des Volkes Israel, auf der Bühne. Tomasz Kajdanski hat für sie,
den umwerfenden Staatsopernchor und einige Tänzerinnen, eine
Choreografie zuckender Lust an der Ermordung mehrerer Juden
ersonnen, von Olaf Freese ausgeleuchtet wie ein Gemälde von Hans
Makart...
Damián Szifrons Inszenierung,
deren realistisches Kolorit zwar manchmal komisch wirken kann,
zeugt gleichwohl von genauem Lesen und Hören... Szifron zeichnet
aber auch Dalila, die Samson betört, ihn in eine Falle lockt und
ihm das Geheimnis seiner Stärke entreißt, als eine komplexe
Figur. Eine Hexe, eine bezahlte Dirne ist sie keinesfalls...
Szifron hat mit Elina Garanca als
Dalila und Brandon Jovanovich als Samson zwei überragende
Sänger, die sich auch darstellerisch auf ein Wagnis einlassen...
Auch stimmlich zielt hier alles
auf Konzentration, Zurücknahme, Intimität, meisterhaft getragen
von der Staatskapelle und Daniel Barenboim... Es ist herrlich!
Man kann gar nicht genug davon bekommen.
JAN BRACHMANN FAZ, 26.11.2019
Zitatende |

|
|
|
Zitat
„WEISSE ROSE”
Schwerin: Ob man will oder nicht,
jede Aufführung von Udo Zimmermanns Kammeroper „Weiße Rose" ist
eine Geschichtsstunde... Anders noch bestätigte sich das in
Schwerin, wo intensiv der Seelenverfassung der beiden zum Tode
Verurteilten nachgegangen wurde...
Die Inszenierung hatte Toni
Burkhardt besorgt... Geschickt nutzte er den Raum, erzeugte
sinnvoll Spannungen, die aus Text und Musik verständlich waren
und ohne Exaltiertheiten in Gesten und Aktionen das Auf und Ab
der Gefühlsmomente verdeutlichten... Zwei hauseigene Kräfte
hatten die Partien übernommen, Katrin Hübner die der Sophie und
Cornelius Lewenberg die des Hans, gesanglich wie in der
Erscheinung, auch darstellerisch beide eine Idealbesetzung...
Die musikalische Leitung hatte
Martin Schelhaas... Zimmermanns teils schrille Klänge mit ihrer
Imitation von Stiefeltritten, von Kettengerassel oder Eiseskälte
bildeten die Mitglieder der Mecklenburgischen Staatskapelle
bedrohlich nach, gestalteten auch die kontemplativen
Erinnerungsbilder feinsinnig und konzentriert...
„Nicht schweigen, nicht mehr
schweigen", stand anfangs auf dem Vorhang. Die Aufforderung
beendete auch die Aufführung. Der Beifall ließ hoffen, dass die
Botschaft angekommen war.
ARNDT VOSS - NMZ ONLINE -
09.12.2019
Zitatende |

|
|
|
Zitat
„DIN0RAH”
Görlitz: Eine Kostbarkeit ist in
Görlitz mit Meyerbeers Oper „Dinorah" zu erleben - als Fest für
die Sänger... Der Besuch zeigt, dass sich die Entdeckung lohnt,
insbesondere wenn man für die nur drei Gesangspartien so
hervorragende Solisten hat wie Görlitz... Die Musik von
„Dinorah" schöpft den ganzen Reichtum spätromantischer Oper aus:
beeindruckende Arien, spannungsreiche Ensembles, große Chöre,
stimmungsvolle Zwischenspiele. Die Neue Lausitzer Philharmonie
kann das, auch wenn sie am Sonntag unter Leitung von Ewa
Strusinska eine ganze Weile gebraucht hat, ihr gewohntes Niveau
zu erreichen.... Der Görlitzer Opernchor überzeugt, insbesondere
an den Stellen kraftvoller Präsenz, mit eindrucksvollem Klang.
Höhepunkt aber waren die Solisten. Jenifer Lary gibt die
Titelfigur im Spannungsfeld zwischen zarter Verletzlichkeit und
kraftvollem Aufbegehren im genretypischen Ausdruck der
Wahnsinnigen, die in den höchsten Tönen das Nichtsagbare
singt...
JENS DANIEL SCHUBERT - SÄCHSISCHE
ZEITUNG - 26.11.2019
Zitatende |

|
|
|
Zitat
„LUCIA DI LAMMERMOOR”
Kiel: ... Gaetano Donizettis
romantisches Meisterwerk ist nach Jahrzehnten zurück, vor allem
weil Hye Jung Lee im Ensemble ideale Voraussetzungen für die in
jeder Hinsicht anspruchsvolle Titelpartie mitbringt... Vor allem
begeistert die Sopranistin mit warmherzig flutenden Piano-Tönen
und erlesenen Pianissimi und entsprechend inniger
Ausdrucksintensität. Das legitimiert die Regie von Paris Mexis
allemal, sie als einzig lebendigen Mittelpunkt in einer in
zeichenhaften Ritualen erstarrten Männergesellschaft vorzuführen
wie ein selten gewordenes menschliches PierettePhänomen.
In den faszinierend bunt
changierenden Farbkreisen, Lichtwänden und -kegeln, die der
Designer George Tellos da in perfekter Zusammenarbeit mit Martin
Witzels Beleuchter-Team in den schottischen Hochmoor-Nebel auf
der leeren Bühne schießt, assoziiert man mehrfach faschistische
Formationen. Aus ihnen heraus werden Akteure auf der Drehbühne
spannungsvoll in Front gebracht oder aus dem (von Lam Tran Dinh
wieder glasklar einstudierten) Chor herausgeschält...
CHRISTINA STREHK - KIELER
NACHRICHTEN - 9.12.19
Zitatende |

|
|
|
Zitat
„LUCIA DI LAMMERMOOR” Darmstadt:
... An der Wahnsinnsarie muss sich die Aufführung von Gaetano
Donizettis „Lucia di Lammermoor" messen lassen. Im Darmstädter
Staatstheater siegt die Sängerin Bianca Tognocchi auf ganzer
Linie... Und es erscheint ganz selbstverständlich, dass diese
Frau auf dem Höhepunkt ihrer Verzweiflung kein bisschen
wahnsinnig wirkt, sondern die Regie übernimmt in dem
mörderischen Spiel, das ihr Bruder Enrico angezettelt hat, um
die moralisch und finanziell bankrotte Familie zu retten...
Diese Frau ist kein Opfer mehr.
Und sie durchbricht den alten
Generationenvertrag der Gewalt. Von Marcos Darbyshires Regie
wird das überzeugend vorbereitet. Seine Inszenierung macht die
abstrakte Unglücksmaschine konkret. Sie zielt auf die Familie
als den tragischen Kern des Unglücks...
Am Ende ist nichts mehr so, wie es
war. Was bleibt, ist der von Frank Lichtenberg quer durch die
Epochen kostümierte Chor der vorangegangenen Generationen, der
die geisterhafte Bluthochzeit gefeiert hat. Die von Sören
Eckhoff einstudierten Chöre agieren ebenso kraftvoll wie
differenziert...
Andriy Yurkevych dirigiert im
engen Kontakt mit der Szene, braucht keine dick aufgetragene
Dramatik, sondern nutzt die geschärften Klangeffekte dieser
beweglich dargebotenen Partitur, die den Schrecken mit Schönheit
präsentiert. So hat diese Inszenierung auch musikalisch
originelle Sichtweisen bereit, wie auch die Regie der
Schauergeschichte neue Plausibilität verleiht: ein spannender,
begeistert aufgenommener Theaterabend, an dem es viel mehr zu
entdecken gibt als den großen Wahnsinn, auf den alle warten.
JOHANNES BRECKNER - DARMSTÄDTER
ECHO - 09.122019
Zitatende
 |
|
|
|
Zitat
„PETER GRIME5”
Mannheim: Einem solchen Mob möchte
man nicht auf der Straße begegnen. „Wer uns verachtet, den töten
wir!", schreien sie, die Bewohner eines Fischerdorfs an der
englischen Küste. Um 1830 spielt die Geschichte, die Benjamin
Britten 1945 vertonte, aber sie könnte auch heute spielen.
Leicht könnte man die Geschichte um eine durchdrehende
Dorfgemeinschaft mit aktuellen Vorkommnissen von Kandel bis
Chemnitz garnieren und aktualisieren. Doch von solchen
Verbindungen ins Heute distanziert sich die Inszenierung der
Oper „Peter Grimes" von Markus Dietz am Mannheimer
Nationaltheater Und das ist gut so...
Hauptakteur des Stücks ist der
riesige Chor (Einstudierung: Dani Juris). Er trägt den größten
Teil der Handlung, sei es in der Fischfabrik, sei es in der
Kneipe, sei es als düsterer Klanghintergrund im großen
Schlussmonolog des Fischers Peter Grimes...
Astrid Kessler (Ellen), Thomas
Berau (Balstrode) und Sung Ha (Richter Swallow) gestalteten
weitere große Rollen sängerisch und in der Darstellung sehr
überzeugend, auch kleinere Rollen waren (zum Teil mit
Chormitgliedern) bestens besetzt...
Markus Dietz' Inszenierung nutzt
die unglaubliche Dynamik, die sowohl die Musik als auch der
soziale Sprengstoff der Geschichte entfacht... Alexander Soddy
weiß das Nationaltheater-Orchester klanglich flexibel, hoch
differenziert, aber auch kraftvoll zu formen: ein sensationeller
Britten-Sound, den so vielleicht nur Engländer hervorbringen
können.
MATTHIAS ROTH -
RHEIN-NECKAR-ZEITUNG - 05.11.2019
Zitatende |

|
|
|
Zitat
„IN DER STRAFKOLONIE”
Ulm: Ist es tatsächlich so?
Erlangt der Mensch Macht über andere, ist es mit der
Menschlichkeit vorbei... Eine Strafkolonie, irgendwo auf einer
Insel dieser Welt. Man denkt an Guantanamo, der Ort kann aber
auch fast überall sonst sein...
Als Franz Kafka seine Novelle „In
der Strafkolonie" 1916 in München öffentlich las, sollen Zuhörer
in Ohnmacht gefallen sein angesichts der Grausamkeiten im Text.
Sich denen emotional zu entziehen, macht die Kammeroper-Version
des Stoffes des US-Amerikaners Philip Glass in der Aufführung im
Podium des Theaters Ulm unmöglich. In unprogrammatischer
Klarheit liefert die „Minimal Music« des Streichquartetts der
Ulmer Philharmoniker unter Leitung von Hendrik Haas einen
gleichsam unbeteiligten Kontrast zu dem, was sich vor den Augen
des Publikums abspielt und was Maria Rosendorfsky (als Besucher
der Strafkolonie) und Martin Gäbler (...) in schockierender
Klarheit singen...
Das Ende der Oper kommt
überraschend und anders als bei Kafka. Es lässt den Besucher
erschrocken und ratlos zurück. Wie war das mit der europäischen
Menschlichkeit?
DAGMAR HUB -
AUGSBURGER ALLGEMEINE - 11.11.2019
Zitatende

|
|
|
|
Zitat
„UN BALLO IN MASCHERA” Oldenburg:
Oft haftet Operninszenierungen die Verlegung in die heutige Zeit
etwas angestrengt Gewaltsames an, auch wenn die Ergebnisse in
der Regel viel Spannung haben. Nicht so beim Deutschlanddebüt
der griechischen Regisseurin Rodula Gaitanou, die jetzt Giuseppe
Verdis Schmerzensoper „Un Bailo in Maschera" in die Jetztzeit
und darüber hinaus in das Milieu der Mafia versetzte... Es
gelingt Gaitanou, tief und differenziert in die liebenden,
wütenden, seelisch verletzten Personen hineinzuhorchen und sie
mit großer, oft krimihafter Spannung agieren zu lassen. Hatte
Michael Talke vor gut einem Jahr in Bremen den Fokus auf die
politische Verschwörerstory gelegt, spielt bei Gaitanou die
Dreiecksgeschichte die Hauptrolle...
Musikalisch stand die
Interpretation unter der Leitung von Hendrik Vestmann auf
höchstem Niveau. Das Oldenburgische Staatsorchester wartete mit
unerhörter dramatischer Wucht auf, erreichte einfach tolle
bedrohliche Crescendi und kontrastierte mit zartesten
Instrumentalfarben (Flöte, Klarinette)... Besonderes Lob dem
Chor, der mit vielen einzelnen, auch komischen Charakteren
auftrat. Besonders lang anhaltender Beifall.
UTE SCHALZ-LAURENZE - NMZ ONLINE -
09.12.2019
Zitatende |


Kalenderblätter
|
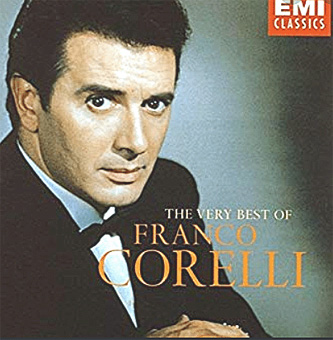 |
Franco Corelli
... am 8. April 1921 geboren
/ Foto EMI |
Zu den Tenor-Idolen
Italiens in der Nachfolge eines di Stefano und del Monaco zählte der in
Pesaro und Mailand ausgebildete Sänger, der neben einer attraktiven
Erscheinung eine sinnliche und metallisch glänzende Stimme sein eigen
nannte.
Nach dem Debüt als Don José in Bizets Carmen 1951 in Spoleto gelang ihm
1954 der Sprung an die Mailänder Scala als Licinio in Spontinis ’La
Vestale’ an der Seite von Maria Callas, mit der er 1958 nochmals als
Gualtiero in Bellinis ’Il pirata’ und 1960 als Donizettis ’Poliuto’
auftrat.
Ein Jahr später debütierte er in einer seiner Glanzrollen. Verdis
Manrico in ’Il trovatore’, an der Seite von Leontyne Price an der New
Yorker Metropolitan Opera, der er bis in die 70er Jahre verbunden blieb
und wo er vor allem auch für seinen unwiderstehlichen Calaf in Puccinis
Turandot neben Birgit Nilsson Ovationen empfing.
Unter seinen vielen Schallplatten findet sich als Mitschnitt auch einer
seiner größten Erfolge - der Manrico unter Herbert von Karajan bei den
Salzburger Festspielen 1962.
|
|
|
Zitat
Schöne
Stimme, schöner Mann: Franco Corelli
Veröffentlicht am 01.11.2003
| Lesedauer: 2 Minuten
Von Jochen Breiholz
Er
war der King of High Cs, als Luciano Pavarotti noch zur Schule
ging. Und er sah besser aus, viel besser: Franco Corelli, das
Idol einer ganzen Generation von Opernfans. Obwohl in den
sechziger Jahren kein Mangel an großen italienischen Tenören
herrschte, verwies Corelli seine Kollegen Mario del Monaco,
Carlo Bergonzi und Giuseppe di Stefano auf die hinteren Plätze:
Keiner von ihnen besaß eine solch strahlende, mühelose Höhe, ein
solches Charisma, einen solchen Sex Appeal. Allerdings war auch
keiner so schwierig.
Corelli, der ursprünglich Schiffsbau studiert hatte, wurde 1954
an der Mailänder Scala über Nacht zum Star - als Partner von
Maria Callas in Spontinis "La Vestale". Auftritte in Paris,
London, Wien, Salzburg folgten. 1961 debütierte er in der
Titelpartie von Verdis "Il Trovatore" an der New Yorker Met,
deren unangefochtener Divo er die nächsten 15 Jahre blieb.
Corelli war berüchtigt für sein Lampenfieber. Jede Aufführung
wurde zur Zerreißprobe für Intendanten, Dirigenten, Kollegen und
Publikum, die bis zur letzten Minute nie wussten, ob der Tenor
nun auftreten würde oder nicht. Meist traf er erst eine
Viertelstunde vor Vorstellungsbeginn im Opernhaus ein, und das
bedeutete nicht, dass er tatsächlich singen werde. An der Met
stand während jeder Corelli-Aufführung nicht nur seine
eifersüchtige Ehefrau Loretta, sondern auch ein fertig
geschminkter und kostümierter Ersatz-Tenor hinter der Bühne, um
für den unberechenbaren Star einzuspringen. Etwa dann, wenn
dessen Partnerin das hohe C länger gehalten hatte als er.
1976 zog sich Corelli von der Bühne zurück. In New York konnte
man ihn bis vor wenigen Monaten noch oft im Café "Taci" am
Broadway sitzen sehen, wie er mit kritischem, wehmütigen Blick
jungen Nachwuchssängern zuhörte. Denen bleibt, wie uns, nur
Franco Corellis discographisches Vermächtnis. Doch das ist für
alle Zeit unausweichlich.
Zitatende
Quelle:
https://www.welt.de/print-welt/article270215/Schoene-Stimme-schoener-Mann-Franco-Corelli.html
|

|
|
|
 |
|
Leo Nucci
am 16. April 1942 geboren
/ Foto Decca |
Er
arbeitete als Autoschlosser.
Dann merkte er, dass er Stimme hatte und begann eine Ausbildung bei
Mario Bigazzi und später von 1959 bis 1968
bei
Giuseppe Marchesi in Bologna. Die leicht ansprechende Höhe
verleiteten die Lehrer, in ihm einen Tenor zu sehen.
Leicht fiel ihm daher 1967 das Debut in Spoleta als Figaro im ’Babier’.
Da es aber nach diesem Erfolg nicht recht weiter ging, nahm er eine
Stelle im Chor der Mailänder Scala ein und gab sich damit zufrieden. Er
konnte singen, bekam Geld dafür und war auf der Bühne.
1975 – also fast zehn Jahre später – gelang im in Padua der Durchbruch.
Er war wieder Figaro und mit dem startete er 1976 an der Scala in
Mailand seine internationale Karriere.
1978 sprang er in London für Ingvar Wixell in ’Luisa Miller’ neben Katia
Riccarelli und Luciano Pavarotti ein.
Ab 1980 an der Met und international mit Amonasro, Luna, Scarpia,
Macbeth, Rigoletto.
|
|
|
Zitat
Nuccis Weigerung im Jahre
1986, wegen des modernen Regiekonzepts in einer
Rigoletto-Inszenierung des Regisseurs
Johannes Schaaf an der
Hamburgischen Staatsoper mitzuwirken, was den damaligen
Intendanten
Rolf Liebermann dazu veranlasste, Schaaf auszuladen und eine
alte, konventionellere Inszenierung von
Gilbert Deflo von den Städtischen Bühnen Nürnberg als Ersatz
einzukaufen, um Nucci zu halten, führte dazu, dass Nucci einigen
Gegenwind bei Teilen des deutschen Publikums und vor allem der
deutschen Presse bekam. Fortan gastierte er auf deutschen
Opernbühnen wegen der deutlich gewordenen gegensätzlichen
Gesinnungen selten.
Zitatende
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Nucci
|
Wie der Sänger noch heute aktiv ist zeigt die Auflistung von
operabase.com
März 2020 – Genua - ’Maskenball’ – René und Regie
July 2020 – Peking – ’Rigoletto’
July bis November 2020 - Mailand Scala - ’Traviata-Germont’ unter Metha
Dezember 2020 – Verona - ’Maskenball’ – René und Regie
Die Suche nach Suche nach „leo
nucci“ ergab 146 Treffer --
https://www.jpc.de/s/leo+nucci

|
|
|
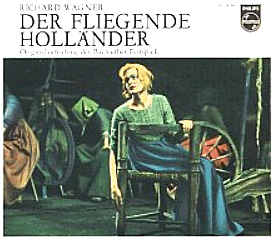 |
|
Anja Silja
am 17. April 1940 geboren
/
Foto Decca |
Mit zehn Jahren gab sie ihr erstes
Konzert im Titania-Palast Berlin, dem dann viele weitere im In- und
Ausland folgten.
Mit sechzehn Jahren begann ihre
Bühnenlaufbahn in Braunschweig mit Rollen wie Rosina/IL BARBIERE DI
SIVIGLIA, Zerbinetta/ARIADNE AUF NAXOS und Micaëla/ CARMEN.
1958 folgten das Staatstheater Stuttgart und die Oper Frankfurt.
Von dort engagierte sie Wieland Wagner 1960 nach Bayreuth als Senta im
FLIEGENDEN HOLLÄNDER.
Bis zu seinem Tod sang sie dort und in fast all seinen Inszenierungen
Europa weit alle großen Wagner-Partien: Isolde, Brünnhilde, Eva,
Elisabeth, Elsa, Venus. Ihr Repertoire umfasste von der Königin der
Nacht, Fiordiligi, Konstanze bis Santuzza, Leonore (Fidelio und Macht
des Schicksals), Desdemona, Lady Macbeth, Lulu und Marie/WOZZECK fast
das ganze gängige Opernrepertoire.
In den letzten Jahren sang Anja Silja
in Wien, Zürich, Barcelona, Berlin, Hamburg, New York, London, Paris,
Aix-en-Provence und beim Glyndebourne Festival hauptsächlich die grossen
Frauenrollen von Leos Janacek wie die Küsterin/JENUFA und Emilia
Marty/DIE SACHE MAKROPULOS, für deren Interpretation sie den
Kritikerpreis des Jahres in England und den Grammy Schallplattenpreis
gewann.
Ortrud/LOHENGRIN, Amme/FRAU OHNE SCHATTEN und Klytämnestra/ELEKTRA
gehören ebenfalls zu ihrem Repertoire wie auch die Mère Marie und Madame
de Croissy/ DIALOGUES DES CARMÉLITES, die sie unter Riccardo Muti an der
Mailänder Scala sang.
Mit James Levine und Pierre Boulez war sie im Jahr 2007 in New York,
Boston und Aix-en-Provence mit ERWARTUNG und PIERROT LUNAIRE von
Schönberg zu hören; ausserdem sang sie ERWARTUNG mit Daniel Barenboim
und der Staatskapelle Berlin beim Lucerne Festival und als
Doppelvorstellung mit Robert Wilsons THE MURDER OF DEAFMAN GLANCE an der
Staatsoper unter den Linden.
Grosse Erfolge feierte sie als Kostelnicka/JENUFA an der Metropolitan
Opera New York und der Mailänder Scala, als Herodias/ SALOME mit Marc
Albrecht und dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg in Strassburg
und in der Salle Pleyel in Paris, mit PIQUE DAME an der Wiener
Staatsoper und an der Komischen Oper Berlin, als Kabanicha/KATJA
KABANOVA am Theater an der Wien und in HÄNSEL UND GRETEL am Covent
Garden London und in Paris.
Zahlreiche Opernaufnahmen unter den grossen Dirigenten
des 20. Jahrhunderts dokumentieren ihr künstlerisches Schaffen, u. a.
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, LOHENGRIN, TANNHÄUSER, Bergs LULU und WOZZECK
(beide für DECCA), SALOME, Fricka in Wagners RING, Schönbergs ERWARTUNG,
Janáčeks DIE SACHE MAKROPULOS und JENUFA (auf Video bzw. DVD) sowie die
Hauptwerke von Kurt Weill. Für ihre Verdienste um Kunst und Kultur wurde
Anja Silja mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Im März 2011 erhielt sie zudem den Europäischen Kulturpreis.
Quelle:
http://www.artistsman.com/de/kunstler/anja-silja/

|
 |
Siegfried Jerusalem
... am 17. April 1940
geboren
Foto EURODISC
|
Der Sohn eines Elektroingenieurs studierte zunächst von 1955 bis 1960
Fagott an der Folkwanghochschule in Essen, arbeitete nach dem Examen als
Fagottist, zuletzt von 1971 bis 1977 im Rundfunkorchester Stuttgart.
Dann begann er 1976 ein privates Gesangsstudium, da so erfolgreich war,
dass er in einer ZDF-Produktion für Franco Bonisolli die Partie des
Barinkay übernahm.
Im gleiche Jahr debütierte er als Lohengrin in Darmstadt und Aachen und
sang bereits 1977 in Bayreuth.
Dort sang er im Parsifal (1987–1988, Regie: Götz Friedrich, Dirigent:
Daniel Barenboim und James Levine), im Siegfried (1988–1992), in der
Götterdämmerung (1989–1992, Regie: Harry Kupfer, Dirigent: Daniel
Barenboim) sowie in Tristan und Isolde (1993–1999, Regie: Heiner Müller,
Dirigent: Daniel Barenboim.
Im April 2019 gastierte er als Balthasar Zorn in den ’Meistersingern’ in
der Staatsoper Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim.
|
|
|
Zitat
Jerusalems frühe Aufnahmen
beweisen zweierlei: daß seine Stimmsubstanz lyrisch ist, von
großer Schönheit, aber auch Weichheit, und daß der Lohengrin
eine Grenzpartie für ihn ist. Sie zeigen außerdem, daß er immer
Probleme mit der Höhe und dem »passaggio« zwischen Brust- und
Kopfregister hatte, wie sie bei seinen Versuchen mit dem
schwierigen Stolzing immer wieder schmerzhaft deutlich wurden.
Den Problemen mit der Höhe geht Jerusalem bei den Siegfrieden
natürlich aus dem Wege, das Problem, daß seine Stimme nicht die
erforderliche Durchschlagskraft für diese Rollen hat, stellt
sich jedoch erneut und verschärft. So wird man konstatieren
müssen, daß Jerusalem dieses Manko durch vermehrte körperliche
Kraftanstrengung auszugleichen sucht, die Stimme jedoch verliert
dabei den ihr eigenen Reiz, und auch wenn sie dadurch an Volumen
gewonnen hat, wird sie wohl nie das angestrebte Ziel völlig
erreichen, weil Substanz und »squillo« dafür einfach nicht
ausreichen. Der internationale Erfolg hinterläßt auf diese Weise
einen problematischen Nachgeschmack für den, der sich von seiner
überzeugenden Bühnenverkörperung nicht das Hören auf die
stimmlichen Phänomene abnehmen laßt.
Zitatende
Quelle:
Jens Malte Fischer – ’Große Stimmen’ – Suhrkamp 1995
|

|
 |
|
Graziella
Sciutti
... am
17. April 1948 geboren
/ Foto DECCA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zitat
Letzte Arie:
Graziella Sciutti (73)
Von
Manuel Brug -
Feuilletonmitarbeiter
Manche haben das Lächeln in der
Stimme. Wenn sie zu singen anheben, geht die Sonne auf
Mit solchen vokalen
Prachtgaben war die Sopranistin Graziella Sciutti ausgestattet.
In den fünfziger und sechziger Jahren war sie der italienische
Inbegriff einer Soubrette, eines leichten Mädchens mit
zauberisch süßem Sang. Ihre freche "Figaro"-Susanna, die
unbotmäßige Norina in Donizettis "Don Pasquale", die schlaue
Rosina im "Barbier von Sevilla", alle diese sopranigen
Luftikus-Madämchen waren ihr Terrain. Mochte ihre Stimme klein,
im Farbenspektrum beschränkt, bisweilen unsicher in der
Intonation sein: Richtig eingesetzt war Graziella Sciutti ein
Fräuleinwunder aus dem Land, wo die Zitronen blühen.
Heute mag man solche Dämchen gerne
emanzipiert. Nur dienen und schön sein will keine mehr. In der
Nierentisch-Ära aber zog man sie sich gerne zart und
zerbrechlich heran, im schwarzrosa gestreiften Rokoko-Petticoat,
mit einem Schönheitsfleck an der richtigen Stelle, einer frechen
Locke auf der milchweißen Stirn und einem Samtband um den
Schwanenhals.
Ein fernes Ideal, dem Graziella
Sciutti gerne entsprach. Sie studierte in Rom, debütierte 1951
in Aix-en-Provence und spezialisierte sich schnell auf Mozart,
Donizetti, Rossini und die Musik des 18. Jahrhunderts. Wenn sie
in modernen Opern auftrat, dann in so aus der Zeit gefallenen
wie Saugets "Die Capricen der Marianne" oder Malipieros "Die
launenhafte Herrin". Mochten andere die große Scala beherrschen,
die Sciutti zierte die auf das Kammerrepertoire spezialisierte
Piccola Scala genauso wie die Festspiele in Aix, Salzburg und
Glyndebourne, die Opern in Wien, London und New York. Nach ihrem
Bühnenabschied unterrichtete sie viel und führte weltweit Regie.
Am häufigsten inszenierte sie, worin sie selbst am hellsten als
Adina glänzte: Donizettis "Liebestrank".
Graziella Sciutti wurde am 17. April
1927 in Turin geboren. Sie starb am 9. April 2001 in Genf.
Zitatende
Quelle:
https://www.welt.de/print-welt/article445394/Letzte-Arie-Graziella-Sciutti-73.html |
|
|
|
|
|
|
|
Die
Suche nach „Graziella-Sciutti“ ergab 32 Treffer -
https://www.jpc.de/s/graziella+sciutti

|
 |
Giulietta
Simionato
... am 12. Mai 1910 geboren
/ Foto: Preiser Records
|
1927 stand die Simionato erstmals auf der Bühne, am Teatro Sociale in Rovigo, in der
heute völlig vergessenen komischen Oper ’Nina non fare la stupida’ von
Giorgio Giacchetti.
1928 sang sie die Lola in Montagnana, der Geburtsstadt von Aureliano
Pertile, dem italienischen Startenor der
dreißiger und vierziger Jahre.
1935 gab die Simionato ihr offizielles Operndebüt, ebenfalls in Florenz,
im Rahmen des
Maggio Musicale Fiorentino, in der
Uraufführung der Oper L'Oro von
Ildebrando Pizzetti.
1936 wurde sie als Anfängerin an die
Mailänder Scala verpflichtet. Sie
debütierte dort als Blumenmädchen in
Richard Wagners ’Parsifal’.
1937 sang sie in der Uraufführung der Oper ’La morte di Frine’ von
Lodovico Rocca. In der Folgezeit
sang Simionato an der Scala allerdings nur kleine Rollen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg größere Rollen: La Cieca in ’La
Gioconda’, die Suzuki in der
Butterfly, die Maddalena im
Rigoletto, die Meg Page im
Falstaff, den Hänsel in
Hänsel und Gretel (1942) und den
Cherubino in
Le nozze di Figaro (1944).
1947 sang sie in Mailand die
Mignon und die Dorabella.
1948 folgte die Rubria in der Oper Nerone von
Arrigo Boito unter der
musikalischen Leitung von
Arturo Toscanini.
1950 übernahm sie die Charlotte in
Jules Massenets Oper
Werther mit
Tito Schipa als Partner. Weitere
wichtige Rollen an der Scala waren
1954 die Angelina in
La Cenerentola,
1955 die Isabella in
L’Italiana in Algeri und
1955 die Santuzza in Cavalleria rusticana, im April
1957 die Giovanna Seymour in
Anna Bolena an der Seite von
Maria Callas[4],
im April
1958 ebenfalls die Giovanna Seymour diesmal an der Seite von
Leyla Gencer,
1960 die Didon in
Les Troyens und
1962 die Valentine in
Die Hugenotten.
Dann kam Salzburg
1962 das Alt-Solo im
Verdi-Requiem in einer Aufführung
mit den
Berliner Philharmonikern unter der
Leitung von
Herbert von Karajan und der
legendäre Mitschnitt einer Troubadour-Aufnahme mit ihr als Azucena, mit
Leontyne Price als Leonore, Franco
Corelli als Manrico, Ettore Bastianini als Luna und Nicola Zaccaria als
Ferrando.
Und es gab eine Neueinspielung der ’Fledermaus’ unter Karajan, der für
den zweiten Akt Gäste einlud wie Birgit Nilsson die ’Wien, Wien nur du
allein’ sang. Dazu kamen die Simionato und Ettore Bastianini mit dem
Song ’Alles, was du kannst, das kann ich viel besser’ aus ’Annie get
your gun’,
1965 begann das Engagement an der
Wiener Staatsoper. Sie trat dort
bis in 11 verschiedenen Partien in über 130 Vorstellungen auf. Sie sang
dort Amneris, Azucena, Carmen, Santuzza, Cherubino, Mrs. Quickly, Eboli,
Maddalena, wiederum Glucks Orfeo und außerdem die Preziosilla in ’Die
Macht des Schicksals’ und die Ulrica in ’Ein Maskenball’.
1959 war sie schon an die
Metropolitan Opera in
New York verpflichtet worden, wo
sie als Azucena am 26. Oktober 1959 unter
Fausto Cleva debütierte. Vier
weitere Spielzeiten sang sie dort.
1965 endete der Vertrag, innerhalb dessen sie in insgesamt 20
Vorstellungen als als Amneris, Santuzza und Rosina zu hören war.
Die Simionato gastierte auch unter anderem an der
Covent Garden Opera in
London (1953, 1964 als Adalgisa,
Amneris und Azucena), an der
Grand Opéra in
Paris, am
Teatro Colón in
Buenos Aires und an der
Bayerischen Staatsoper in
München.
Nach ihrer Karriere war sie als Gesanglehrerin tätig, war in Jurys
verpflichtet und gönnte sich sonst ein gemütliches, aber doch sehr am
Musikleben teilnehmendes, Rentnerleben.
Sie starb wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag.
Die Suche nach
„Giulietta Simionato“ ergab 102 Treffer -
https://www.jpc.de/s/giulietta+simionato

|
 |
James King
... am 22. Mai 1925 geboren
/ Foto: ORFEO |
Der Vater war Sheriff in Dodge City in Kansas.
Er studierte an den Universitäten von
Louisiana und Cansas City und debütierte nach einer mehrjährigen
Tätigkeit als Musikdozent 1961 als Bariton.
Nach einer Umschulung zum Tenor gelang ihm noch im gleichen Jahr mit dem
Don José in Bizets Carmen an der San Francisco Opera das Debüt im neuen
Fach.
1962 wurde er Mitglied der Deutschen Oper Berlin und der Bayerischen
Staatsoper München, wo er sein Repertoire als Zwischenfach-Tenor
aufbaute und glanzvolle Erfolge feierte.
Die feste Stimme mit metallischem Klang und sein attraktives Aussehen
waren vor allem für die gefürchteten heroischen Partien von Richard
Strauss ideale Voraussetzungen; den Bacchus in Ariadne auf Naxos sang er
in seiner Laufbahn in über 200 Aufführungen.
Als Kaiser in ’Die Frau ohne Schatten’ trat er an den Opernhäusern von
London und New York auf. An der Met hatte er 1966 als Florestan in
Beethovens ’Fidelio’ debütiert und war dort auch ein geschätzter
Interpret im Wagner-Repertoire.
Er mied aber den Tannhäuser, die Siegfriede und den Tristan.
Bei den Bayreuther Festspielen feierte man ihn von 1965 bis 1976 vor
allem als ’Lohengrin’, Parsifal und Siegmund in ’Die Walküre’.
Den Aegisth in Strauss' ’Elektra’, den er schon 1964 bei den Salzburger
Festspielen gesungen hatte, gestaltete er bis in die 90erJahre noch an
den Opernhäusern von Wien, München und Berlin.
Die
Suche nach ’James King‘
ergab 58 Treffer
-
https://www.jpc.de/

|
|
|
 |
|
Ingeborg
Hallstein
am 23. Mai 1936 geboren
/ Foto Acanta |
|
|
|
Zitat
Sie
erhielt ihre gesamte Ausbildung durch ihre Mutter, die
Sopranistin Elisabeth Hallstein. 1956 debütierte sie am
Stadttheater von Passau als Musetta in «La Bohnme».
1958-59 hatte sie ein Engagement am Stadttheater von Basel. Seit
1959 trat sie am Theater am Gärtnerplatz in München auf und
wurde im gleichen Jahr Mitglied der Staatsoper von München. Es
entwickelte sich nun eine glanzvolle internationale Karriere.
Seit
1960 wirkte sie bei den Festspielen von Salzburg mit; hier sang
sie 1960 die Rosina in «La finta semplice» von Mozart, am 6. 8.
1966 in der Uraufführung der Oper «Die Bassariden» von H. W.
Henze.
1961 gab sie in Salzburg ein Mozart-Konzert.
Erfolgreiche Gastspiele an der Staatsoper von Wien, an der
Londoner Covent Garden Oper und an den großen südamerikanischen
Operntheatern. 1962 gastierte sie am Teatro Colön von Buenos
Aires. Weitere Gastspiele an den Staatsopern von Hamburg,
Stuttgart und Dresden, an den Opern von Köln, Frankfurt a. M.,
Leipzig, Karlsruhe, Mannheim und Kassel, in Rom, Venedig, Paris,
Brüssel, Kopenhagen, Stockholm, Genf, Zürich, Amsterdam,
Montreal und Ottawa.
1962 sang sie in der Eröffnungsvorstellung des renovierten
Theaters an der Wien in Wien die Königin der Nacht in der
«Zauberflöte» unter von Karajan.
Von den vielen Opernpartien, die sie gestaltet hat, seien
genannt: die Konstanze in Mozarts «Entführung aus dem Serail»,
die Fiordiligi wie die Despina in «Cosi fan tutte», die Susanna
in «Figaros Hochzeit», die Nonna im «Don Pasquale», die Frau
Fluth in den «Lustigen Weihern von Windsor» von Nicolal, die
Marie in «Zar und Zimmermann von Lortzing, die Sophie im
«Rosenkavalier», die Zerbinetta in «Ariadne auf Naxos», die
Annchenim «Freischütz», die Gilda im «Rigoletto, die Traviata,
die Nedda im «Bajazzo», die Adele in der «Fledermaus», dazu
viele weitere Aufgaben. Zugleich hatte sie eine triumphale
Laufbahn als Konzert- und Operettensängerin;
1964 erregte sie großes Aufsehen, als sie bei der Uraufführung
der Solo-Kantate «
Being Beauteous
» von Hans-Werner Henze diese schwierige Koloraturpartie
innerhalb von 24 Stunden einstudierte.
Sie gehörte zu den beliebtesten Sängerinnen, die im deutschen
Fernsehen auftraten. Ab
1981 war sie Professorin an der Musikhochschule Würzburg.
Hervorragend schöner, technisch brillant geführter
Koloratursopman; auf der Bühne wurde auch das darstellerische
Talent der Künstlerin bewundert. Schallplatten: DGG («Frau ohne
Schatten» von R. Strauss, Querschnitt «Zar und Zimmermann»),
Ariola-Berteismann, BASF (Lied-Aufnahmen), Eurodisc (Szenen aus
Operetten, vollständige Operette «Im weißen Rößl» von Benatzky,
«Abu Hassan» von Weber), HMV (Marzeffine im «Fidelio»),
Movimento Musica (Königin der Nacht in der «Zauberflöte»
Zitatende
Quelle:
Kutsch – Riemers – Großes Sängerlexikon – Frank Verlag Bern -
1987 |
Die
Suche nach ’Ingeborg
Hallstein‘ ergab 40 Treffer
-
https://www.jpc.de/s/ingeborg+hallstein

|
|
|
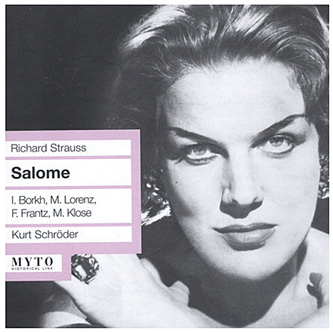 |
|
Inge Borgk
am 26. Mai 1921 geboren
/ Foto MYTO |
|
|
|
Zitat
Inge Borkh: die Hochdramatische
als Frau von heute
Sie
war so modern, so direkt.
Als sie, die ursprünglich Schauspielern hatte werden wollen,
sich in den Fünfzigern anschickte, als Hochdramatische die
Opernbühnen der Welt zu erobern, da muss
Inge Borkh wie ein
Wirbelsturm, zumindest aber wie ein super erfrischender
Frühlingswind gewirkt haben. Waren doch Sieglinden, Elektras,
Turandots, „Fidelio“-Leonoren, Färberinnen, (von Tänzerinnen
gedoubelte) Salomes doch damals (die verehrungswürdige Birgit
Nilsson eingeschlossen, die freilich alles mit ihren Stimmfluten
wett machte) eher statuarische Damen, Singsäulen, Musiktruhen
gar. Karl Löbl prägen dem bösen Ausspruch von der „Kredenz auf
Radln“.
Ein viel flatterhafterer, nervös-zeitgemäßer, ja eben
backfischhafter Opernzugvogel war indessen die Mannheimerin Inge
Borkh, geborene Simon, in der Schweiz groß geworden, weil ihr
Vater Jude war.
Sie begann 1944 in Luzern als Operetten-Alt und endete 1973 in
Palermo als Elektra. Das jugendliche Feuer ihres tragfähigen
Soprans prädestinierte Borkh als zeitgenössische Tragödin, die
die wilden Weiber der Opernbühne menschlich machte und
psychologisierte.
In
der Schweiz machte sie erstmals Furore als Magda Sorel in der
deutschsprachigen Erstaufführung von Gian Carlo Menottis heute
zu Unrecht vergessener Oper „Der Konsul“. Dies war ihr
Durchbruch zu internationalen Erfolgen, gefolgt mit Engagements
in den Opernhäusern Wien, München, Berlin, London, New York und
San Francisco.
1952 sang sie bei den Bayreuther Festspielen die Freia und die
Sieglinde.
1957 übernahm sie bei den Salzburger Festspielen die Titelrolle
in einer längst legendären, zum Glück akustisch festgehaltenen
„Elektra“ unter Dimitri Mitropoulos.
Sie verbrannte sich dabei, verabschiedete sich
früh von der großen Bühne und startete eine zweite Karriere als
Diseuse.
Verheiratet war sie mit dem jugoslawischen Bass-Bariton
Alexander Welitsch (1906–1991).
Bis fast um Schluss reiste Inge Borkh ihren klassischen
Lieblingen hinter,
Mariss Jansons und
Christian Gerhaher zum
Beispiel.
„Ich komm‘ vom Theater nicht los“, hieß eines ihrer Programme.
Tatsächlich kommt man bis heute von dieser weißglühenden, Sinn
und Klang transportierenden Stimme nicht los. Ihre Aufnahmen
sind deutsch im besten Sinne: seelenvoll und beherzt.
Vielleicht singt man heute ihre großen dramatischen Rollen,
Salome, Elektra, Färberin, Lady Macbeth, Tosca, Turandot, aber
eben auch Cherubinis Medea oder Orffs Antigone, schöner,
geschmeidiger.
Aber bei der Borkh, dieser lustigen, geerdeten Person, war es
immer großes Drama. Und so relativiert sich so machen
zeitgenössische Salome-Sensation, denkt man an die Wonderwoman
der Borkh zurück.
Am 26. August 2018 ist sie gestorben, gesegnete 97 Jahre alt.
Zitatende
Quelle:
http://klassiker.welt.de/2018/08/27/zum-tod-von-inge-borkh-die-hochdramatische-als-frau-von-heute/
|
Die
Suche nach ’Inge Borgk‘
ergab 80 Treffer
-
https://www.jpc.de/s/inge+borkh

|
|
 |
|
George London
am 30. Mai 1920 geboren
Foto:
DECCA |
|
|
|
Zitat
Er studierte in Los Angeles und New York und
bildete 1947, gemeinsam mit Mario Lanza und Frances Yeend das
»Belcanto-Trio« für weltweite Konzerttourneen.
1949 gelang ihm durch die Verpflichtung von Karl Böhm der Sprung
an die Wiener Staatsoper als Amonasro in Verdis Aida. Hier hatte
er mit seinem suggestiv dramatischen Gesang und seiner
machtvollen Autorität große Erfolge in seinen zentralen Partien
vor allem aber als Wagner Interpret, als der er von 1951 bis
1964 auch bei den Bayreuther Festspielen Geschichte machte. Die
Titelrolle in Der fliegende Holländer und der Amfortas in
Parsifal gehören zu seinen singulären Leistungen;
1962-64 sang er in der Ring-Inszenierung von Wieland Wagner am
Opernhaus Köln auch den Wotan und Wanderer. Er war mit seiner
intelligenten Gestaltung und der szenischen Präsenz der Prototyp
des singenden Darstellers, gefeiert an den großen Bühnen von
Mailand bis New York. Der Met, wo er 1951 als Amonasro debütiert
hatte, gehörte er bis 1960 an und wurde dort vor allem für seine
Interpretationen des Scarpia in Puccinis Tosca, des Mandryka in
Strauss' Arabella sowie der Titelhelden in Mozarts Don Giovanni
und Mussorgskis Boris Godunow umjubelt. Die Partie des
russischen Zaren gab er als erster ausländischer Sänger 1960
auch am Moskauer Bolshoi-Theater.
Noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde er 1968 zum
Künstlerischen Leiter des Kennedy Center Washington ernannt;
Anfang der 70er Jahre trat er auch als Regisseur in Erscheinung
und inszenierte 1973-75 an den Opernhäusern von Seattle und San
Diego den ersten englischsprachigen Ring in den USA. Viele
bedeutende Schallplattenaufnahmen erinnern an den grandiosen
Interpreten.
Zitatende
Quelle:
Bassermann Opernführer – Gütersloh - 2000 |


Die
Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger schreibt:
|
|
|
Zitat
Staatsballett Berlin
Auf dem Rücken des
Ensembles
Beim Berliner Staatsballett gibt
es neue Unruhe: Johannes Öhmann und Sasha Waltz wollen ihre
gemeinsame Intendanz schon wieder aufgeben - dabei liegt der
Amtsantritt noch nicht mal ein halbes Jahr zurück. Leidtragende
sind die Tänzerinnen.
Die Berliner Choreografin und der
schwedische Tänzer und Kulturmanager waren erst zum 1. August
2019 als Co-Intendanten berufen worden. Weil der glücklose
Vorgänger Nacho Duato das Staatsballett aber schon ein Jahr vor
dem Vertragsende verlassen hatte, sprang Johannes Öhman ein und
übernahm für die Spielzeit 2018/19 allein die Leitung der
Kompanie. Die Kritiker der Berufung werden sich vermutlich
bestätigt fühlen. Der Protest war seinerzeit in einer
Online-Petition „Rettet das Staatsballett!" mit fast 20.000
Unterschriften kulminiert. Vor allem gegen Sasha Waltz richtete
sich der Widerstand. Als Choreografin mit einer dezidiert
zeitgenössischen Bewegungssprache wurde ihr von Tänzer*innen die
Fähigkeit abgesprochen, eine klassische Kompanie zu leiten.
Viele Vorbehalte schienen sich in der Zwischenzeit gelegt zu
haben Öhmann und Waltz wollten eine Brücke schlagen zwischen dem
klassischen Ballett und dem zeitgenössischen Tanz. Sie kündigen
einen ausgewogenen Spielplan an, der zu fünfzig Prozent aus
klassischen Produktionen und zur anderen Hälfte aus
zeitgenössischen Werken bestehen sollte. „So wie sie sich in der
Öffentlichkeit präsentieren, geht es beiden nicht um einen
Umsturz, um das Killen der Klassik, sondern um einen Ausgleich",
schrieb der Berliner Tagesspiegel.
Vor allem Johannes Öhman war immer
ein glühender Verfechter des Doppelspitzen-Modells: „Alle
künstlerischen Entscheidungen werden von uns beiden getroffen",
betonte er stets. Von dem fruchtbaren Dialog mit Waitz hat er
immer wieder geschwärmt. Dass das Duo tatsächlich keineswegs so
perfekt harmonierte, war indes kein Geheimnis. Man spürte
deutlich, dass Sasha Waltz, kaum war sie im Boot, den Hut
aufhatte. Nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Machtgefälle
kam, das Öhmann jetzt auflöst und dem Ruf an seine Heimatstadt
Stockholm folgt, um dort Künstlerischer Leiter und Managing
Director am renommierten ‚Dansenhus', dem Schwedischen Haus für
Tanz, anzunehmen - nach jüngsten Informationen schon zum 1.
März. Ende des Jahres will dann auch Sasha Waltz das Haus
verlassen und sich auf ihre künstlerische Arbeit als
Choreografin konzentrieren.
In einer Erklärung des
Ballett-Vorstands, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert,
ist von Empörung über die Rücktritte die Rede: „Mehr noch sind
wir enttäuscht, dass wieder einmal wir Tänzerinnen und Tänzer
die Leidtragenden dürftigen Kulturmanagements sind." Bei ihrem
Antritt hätten die Intendanten einen Dreijahresplan angekündigt,
um das Staatsballett wieder an die europäische Spitze zu
bringen, hieß es. Nun offenbare sich „die Oberflächlichkeit
dieser Pläne". Das Vertrauen in die Fähigkeit des Senats, die
Kompanie „wohl überlegt in die Hände einer ehrlich engagierten
Ballettdirektion zu geben", sei erschüttert. Seit 2014 sei das
Land Berlin nicht in der Lage, dem Staatsballett Kontinuität und
künstlerische Perspektive zu garantieren: »Uns stellt sich die
Frage, warum wir bis in die Mitte der nächsten Spielzeit mit
einer künstlerischen Leitung weiter zusammenarbeiten sollten,
die uns ohnehin kurzfristig verlassen will." Dies werde zu einer
weiteren chaotischen und von Umstellung geprägten Spielzeit
führen. Obwohl man seinerzeit gegen die Ankündigung der
Co-Direktion von Herrn Öhman und Frau Waltz protestierte, habe
Kultursenator Klaus Lederer (Linkspartei) gebeten, dem Duo eine
Chance zu geben.
Für Tänzer*innen hätten derartige
politische Prozesse katastrophale Folgen - beruflich und
persönlich: »Für eine aktive Bühnenkarriere sind uns
durchschnittlich fünfzehn bis zwanzig Jahre gegeben. Angesichts
dessen ist jedes Jahr der künstlerischen und damit beruflichen
Ungewissheit gravierend."
Das Ensemble will in die
Entscheidungsfindung über die nächste künstlerische Leitung
eingebunden werden. Die Tänzer* innen sollten in einer
Findungskommission mit Stimmrecht von Anfang an beteiligt sein.
Nach Redaktionsschluss
verkündetete Sasha Waltz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit Johannes Öhmann, sie sei von dessen Entscheidung überrascht
worden und wolle nun überlegen, in welcher personellen
Konstellation sie beim Staatsballett bleiben könne. Danach wolle
sie einen Vorschlag vorlegen. Ihr als Vertreterin des modernen
Tanzes müsste jemand mit »klassischer Expertise" zur Seite
stehen. Sie könne sich aber nicht vorstellen, dass so jemand
jetzt »aus dem Hut gezaubert« werde.
Zitatende
Quelle: Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger Heft 2 2020 –
Seite 17 |

|
|
|
Zitat
BURGTHEATER
Prekäre Arbeitsbedingung für
„Choristen"
Am Wiener Burgtheater gibt es
seit vergangenem Herbst,,Die Bakchen" von Euripides zu sehen.
Die sogenannten Choristen" protestieren nun gegen prekäre
Arbeitsbedingungen.
Die Inszenierung, von der
Kritik hochgelobt, ist für das in den Vorjahren von einer
Finanzkrise gebeutelte Burgtheater sehr aufwändig gestaltet,
allein das Bühnenbild soll 350.000 Euro gekostet haben. Neben
den wohlbestallten Solisten lebt das Stück vor allem von 15
sogenannten Choristen - Schauspieler*innen und
Schauspielschüler*innen, die als zentrales Element den Gutteil
der Handlung vorantreiben. In der dreistündigen Inszenierung
agieren sie keineswegs statisch. Wie alle Darsteller sind auch
sie auf Laufbändern in ständiger Bewegung, ihre Sprecheinsätze
müssen exakt synchron ablaufen, die Textmenge ist groß und
herausfordernd, physische wie psychische Hochleistung ist
gefordert. Nun haben nach Medienberichten sämtliche „Choristen"
zum Spielzeitende ihre Verträge gekündigt und als Begründung
ihre Arbeitsbedingungen angeführt. Während der Proben erhielten
sie demnach zwar Pauschalzahlungen, für die Aufführungen danach
aber nur noch Gagen von 300 Euro pro Aufführung - drei- oder
viermal im Monat. Doch ein Zuverdienst, so der Vorwurf, wird vom
Burgtheater massiv erschwert. Das Haus hat sich zum einen die
Entscheidung darüber vorbehalten, welche Zusatzengagements die
»Choristen" annehmen dürfen. Zum zweiten würden
Vorstellungstermine erst sechs Wochen vorher bekanntgegeben, was
jede Langzeitplanung unmöglich mache.
Zitatende
Quelle:
Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger Heft 2
2020 – Seite 16
|


In Deutschland wurden nach unwidersprochenen
Angaben des Bundes der Steuerzahler seit über vierzig Jahren jährlich
Steuergelder in Höhe von ca. € 30.000.000.000 durch die öffentliche Hand
verschwendet. Berechnete man den Zinseszins mit 4% dann kommen wir auf
eine Verschwendungssumme von ca. € 2.160.000.000.000.
Das entspräche in etwa unserer heutigen öffentlichen Verschuldung des
Bundes. Stünden diese Gelder zur Verfügung, dann gäbe es keine Schulden,
die Renten wären entschieden höher, die Steuerlast wäre niedriger und
man könnten bürgernahe Aufgaben bewältigen, hätten bessere Straßen, eine
bessere Infrastruktur, etc..
Auch der Bundesrechnungshof prangert jährlich die
Steuergeldverschwendung an.
So die Meinung des Steuerzahlerbundes.
Die Leitung der Nds. Staatstheater Hannover GmbH hatte zum Beginn der
Spielzeit 2019/2020 gewechselt.
Eine wirtschaftliche wie künstlerische Verbesserung der Situation der
Gesellschaft gegenüber der Zeiten Puhlmann und Klügl ist in Hinsicht auf
die Nds. Staatsoper Hannover nicht zu erkennen.
Ein nicht durch Zufälle wie Corona-Virus plötzlich entstandener, sondern
geplanter Leerstand des Großen Hauses, war für den März mit 11 Tage
angesetzt.
Geplante Belegung Nds. Staatsoper Hannover – Großes Haus – 3/2020
|
Datum |
|
|
|
Anzahl
der Veranstaltungen |
|
|
|
|
Belegung |
|
|
|
|
|
|
Ballett |
Sonstige |
Oper |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.
März |
|
|
1 |
Ballett-Gastspiel |
|
|
01 |
|
02.
März |
leer |
01 |
|
|
|
|
|
|
03.
März |
leer |
02 |
|
|
|
|
|
|
04.
März |
leer |
|
2 |
3 Generationen |
|
|
02 |
|
05.
März |
|
|
3 |
3 Generationen |
|
|
03 |
|
06.
März |
leer |
03 |
|
|
|
|
|
|
07.
März |
leer |
|
|
|
|
Barbier |
01 |
04 |
|
08.
März |
|
|
|
|
Kinderfest
Kinderfest |
|
05
06 |
|
09.
März |
leer |
04 |
|
|
|
|
|
|
10.
März |
leer |
05 |
|
|
|
|
|
|
11.
März |
|
|
|
|
|
Alcina |
02 |
07 |
|
12.
März |
leer |
06 |
|
|
|
|
|
|
13.
März |
|
|
4 |
3 Generationen |
|
|
08 |
|
14,
März |
|
|
|
|
|
Alcina |
03 |
09 |
|
15.
März |
|
|
|
|
Poetry Slam
|
Barbier |
04 |
10
11 |
|
16.
März |
leer |
07 |
|
|
|
|
|
|
17.
März |
leer |
08 |
|
|
|
|
|
|
18.
März |
|
|
5 |
3 Generationen |
|
|
12 |
|
19.
März |
leer |
09 |
|
|
|
|
|
|
20.
März |
|
|
|
|
Grand Hotel |
|
13 |
|
21.
März |
|
|
|
|
|
Greek Passion |
05 |
14 |
|
22.
März |
|
|
6 |
3 Generationen |
|
|
15 |
|
23.
März |
leer |
10 |
|
|
|
|
|
|
24.
März |
leer |
11 |
|
|
|
|
|
|
25.
März |
|
|
|
|
|
Greek Passion |
06 |
16 |
|
26.
März |
|
|
7 |
Nijinski |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.März |
|
|
|
|
|
Tosca |
07 |
18 |
|
28.
März |
|
|
|
|
|
Greek Passion |
08 |
19 |
|
29.
März |
|
|
|
|
Sinfoniekonzert |
|
|
20 |
|
30.
März |
|
|
|
|
Sinfoniekonzert |
|
|
21 |
|
31.
März |
|
|
8 |
3 Generationen |
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summen |
11 Leerstände |
22
Veranstaltungen |
|
|
|
|
|
|
8 x Oper
4 x Konzert incl.
2 x Kinderfest
8 x Ballett incl. 1 x
Ballett-Gastspiel
|
|
Es wurden für den März 2020 Oper nur 8 Mal
geplant, dazu 4 Konzerte und 8 Mal Ballett.
Der dritte Rang war bei den Vorstellungen ‘Alcina‘ geschlossen (die
Premiere war ausgenommen), obwohl die Geschäftsführerin der Nds.
Staatsoper Hannover GmbH für die Ausgabe der HAZ vom 26. November 2019
feststellte, dass der dritte Rang geöffnet bleiben solle, da es Menschen
gebe, die lieber im dritten Rang als im Parkett säßen.
Deutlich erkennbar die nicht verkauften Karten und der nicht
dargestellte und somit nicht in den Verkauf gegebene dritte Rang
Der Jahresspielplan beinhaltet Produktionen aus früheren Jahren, die
alle erfolglos waren, die dem Wert des Hauses als Nds. Landeshauptstadt
nicht entsprechen und vom Publikum bereits abgelehnt wurden.
So sollen die alten Produktionen ‘Aida‘, ‘Fledermaus‘, ‘Rigoletto‘ und
‘Giovanni‘ zum Ende der Spielzeit 2019 / 2020 im Mai und Juni 2020
wieder auf den Spielplan kommen, so dass davon auszugehen ist, dass sie
in der kommenden Spielzeit 2020/2021 wieder gezeigt werden.
Das entspricht nicht der Vorstellung eines ausgewogenen Spielplans,
zumal die ‘Spieloper‘ völlig außen vor bleibt.

Bericht zur
Veranstaltung des RWV Hannover
mit der Geschäftsführerin der Nds. Staatsoper Hannover GmbH
|
|
Zitat
“Die
Veranstaltung im Landtag war mit ca. 50 Personen gut besucht -
es waren auch Teilnehmer aus dem Freundeskreis dabei. Nach den
obligatorischen Fragen des Lebens, der Kindheit, der Ausbildung
und nicht zuletzt der Aufstieg in die Hierarchie verkündete die
Geschäftsführerin in aufgesetzter Freundlichkeit, dass in dieser
Saison an 220 Tagen Opernaufführungen, Konzerte,
Ballettaufführungen, Gastspiele etc. erfolgen. Sie lobte alle
Mitarbeiter vor, hinter und auf der Bühne (obgleich ich bereits
andere Aussagen gehört habe).
Zu den Operninszenierungen sagte sie, dass man auch ein jüngeres
Publikum im Auge haben und die Interpretation immer offen
bleiben und kein Ergebnis vorgeben dürfe.
(Seltsam - ich erlebe andere Libretti). Die Regisseure hätten
oft ein tieferes historisches Wissen der darzustellenden Figuren
(als der dumme Opernbesucher!!!).
Eine Wagner-Oper sei auch in Planung - leider habe der
vorgesehene Regisseur aus privaten Gründen kurzzeitig abgesagt.
Was haben wir für schöne Opernabende v o r der Ära Puhlmann
und Klügl erlebt.....
Die Dame berichtete weiter, dass im Jahre 2017 bei ihrer
Assistentin in Basel ein Anruf aus dem hannoverschen
Kultusministerium eingegangen sei und man um Rückruf bat.
Da keine Beziehung hierzu vorhanden war, wurde gegoogelt und
zurückgerufen. Der Mitarbeiter legte ihr dann nahe, sich für die
freiwerdende Intendanz zu bewerben.
Hat‘ ja geklappt, und darüber bin ich doch sehr erstaunt.
Ist das der übliche Filz in den Behörden?“
Zitatende |
Kommentar
Geradezu empörend die Meinung der
Frau Geschäftsführerin, wonach
“man auch ein jüngeres Publikum im Auge
haben und die Interpretation immer offen bleiben und kein Ergebnis
vorgeben dürfe.
Hier liegt ja gerade das Problem, dass die Nds. Staatsoper Hannover GmbH
die inzwischen nichtmehr vorhandene Allgemeinbildung – vornehmlich der
jüngeren der heutigen Besucher ausnutzt, um mit ihrem szenischen
‘Heck-Meck‘ das Haus zu füllen, die Fälschung als wahr und richtig
anzubringen, statt dem Publikum das Original im Rahmen des
Bildungsauftrages vorzustellen.
Beispielhaft hierzu die bisher laufende ‘Tosca‘-Produktion.
In der Fortsetzung des Berichts wird erwähnt,
dass in dieser Saison an 220 Tagen
Opernaufführungen, Konzerte, Ballettaufführungen, Gastspiele etc.
erfolgen.
Fest steht, dass die Oper im Spielplan kaum vorkommt. Im März 2020
waren ganze acht (in Ziffern 8) Vorstellungen geplant:
2 x Barbier
2 x Alcina
1 x Tosca
3 x Greek Passion
Um auf die – von der Frau Geschäftsführerin der Nds. Staatsoper Hannover
GmbH - erwähnten 220 Tage Präsentationen zu kommen, muss man dann
sämtliche Spielstätten zusammenfassen, als da sind
Pseudoveranstaltungen, die mit der Oper nichts zu tun haben und nur
ablenken und füllen sollen wie z.B.
- ‘Kuckuck‘ Oper - für Babys von 0 – 18 Monate‘ oder
- ‘Zählen und erzählen – Musiktheater für Unerwachsene‘ oder
- ‘Sturmfrei – Unterhaltsamer Ballettabend, während die Kinder in
einem Workshop selber
tanzend aktiv werden‘ oder
- ‘Opera Insiders – Spannende Begegnungen mit Mitarbeiter*innen des
Opernhauses‘
Die 31 Kalendertage im Großen Haus des März 2020 aber wurden vom Plan
her mit acht Vorstellungen Oper mit 4 x Konzert und Kinderfest, 8 x
Ballett gefüllt, der Rest waren 11 Tage Leerstand zu Lasten der
Steuerzahler.
Von Ausgewogenheit im Spielplan kann keine Rede sein. Und von Vielfalt
schon garnicht.

Die Nds. Staatstheater Hannover GmbH gab
am 11. März 2020 bekannt:
|
|
Zitat
Hinweis zum Coronavirus
WIR SPIELEN WEITER!
Aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamts der Region
Hannover reduzieren wir die Platzkapazitäten im Opernhaus auf
unter 1000 Sitzplätze. Die Spielstätten Schauspielhaus, Ballhof
Eins und Ballhof Zwei sind davon nicht betroffen.
Für die stattfindenden Veranstaltungen der Staatstheater
Hannover besteht nach aktueller Einschätzung keine besondere
Gefährdung. Wir beobachten die Lage sehr genau und stehen in
regelmäßigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden.
Die empfohlenen Schutzmaßnahmen wurden an den Staatstheatern
umgesetzt (Hinweisschilder zu Hygienemaßnahmen,
Handdesinfektionsspender in den Eingangsbereichen, erhöhte
Frequenz der Reinigungszyklen, aufmerksames
Gesundheitsmanagement für Mitarbeitende mit
Krankheitssymptomen).
Zitatende
Quelle:
https://www.staatstheater-hannover.de/oper/ |

Am Freitag, den 13. März 2020, verkündete
dann die Nds. Staatstheater Hannover GmbH die Schließung ihrer
Spielstätten.
Zur Problematik der Stückverträge – d.h. wer nicht singt, wer nicht
spielt, bekommt auch kein Geld – kein Wort des Hauses zu dieser
Problematik.
Die Leitung der Nds. Staatsoper Hannover GmbH wurde sträflicherweise von
einer rot-grünen Landesregierung – ohne öffentliche Ausschreibung der
’Planstelle Opernintendanz’, unter Außerachtlassung jeglicher
Transparenz – aus dem Hinterzimmer des Ministeriums in die Hände einer
Frau gelegt, die nach dem amerikanischen Prinzip des ‘Hire-and-Fire‘
hantiert.
Das bestehende Ensemble wurde von ihr aufgelöst.
Von sozialen Aspekten war und ist bei ihr offensichtlich keine Rede.


Schlussbemerkung
Wer über den Verlauf des Zweiten
Weltkriegs - pompös als ‘Tausendjähriges‘ – ‘Drittes Reich‘ angekündigt
– liest, kann doch nur am Verstand der Männer, die sich um den ‘Führer‘
scharten zweifeln.
So viel Blindgläubigkeit, Dummheit, Verbohrtheit, Eitelkeit ist
unbegreiflich.
Haben wir aus der Katastrophe gelernt?
Sind wir wieder in Gefahr, Schreihälsen hinterherzulaufen, religiös
getarnten zerstörerischen Zivilisationsfeinden aus falsch verstandener
Toleranz viel zu viel Raum und Schutz zu geben um eine kriminelle
Parallelgesellschaft aufzubauen, die im Namen ihrer archaischen
Gebräuche unsere humanistische Ordnung untergräbt?
Zahlen wir riesige Summen an Steuergeldern an Familien, deren Frauen aus
religiösen Gründen nahezu rechtlos nur dazu dienen müssen, die
Kinderzahl zu vergrößern, um die Macht der Patriarchen zu erhalten und
sogar noch zu erhöhen?
Ist es nicht möglich, die Streitereien der politischen Häuptlinge zu
versachlichen, um gemeinsam die dringenden Probleme:
Bildung, Klima, Verkehr, Überbevölkerung in den Griff zu bekommen?
Es ist zwar biologisch festgelegt, dass das Männchen für die
Reviersicherung und Fortpflanzung zuständig ist, aber der Homo sapiens
wird in seinem Machttrieb zum Feind seiner selbst.
Mit bewundernswerter Klarheit hat es Richard Wagner im ‘Rheingold‘
ausgedrückt und ich habe Frickas Worte immer mit tiefer Überzeugung
gesungen:
Wotan schildert sich und seine Ziele in
der zweiten Szene von ‘Das Rheingold‘ eindeutig so:
Mannes Ehre
Ewige Macht
ragen zu
Endlosem Ruhm
- wohingegen Fricka argumentiert:
Was ist
euch harten
doch heilig und wert,
giert ihr Männer nach Macht
ML Gilles
 www.bi-opernintendanz.de
www.bi-opernintendanz.de

Impressum

erscheint als nichtkommerzielles Beiblatt zu

- ausgezeichnet mit dem Kulturförderpreis der Stadt Regensburg -
kulturjournal.de - Holzländestraße 6 - 93047 Regensburg
Ersterscheinung der Ausgabe Regensburg am 27.07.2007
Erscheinungsweise: kulturjournal-regensburg zehn Mal pro Jahr von
Februar bis August und Oktober bis Dezember
Verteilung:
Direktversand, Hotels, Theater, Galerien, Veranstaltungsorte,
Tourist-Info, Bahnhöfe
Direktversand an ausgewählte Leserschaft u.a.
Mitglieder der
Bürgerinitiative-Opernintendanz.de
Niedersächsischer Landesrechnungshof,
Niedersächsische Landesregierung,
Staatsanwaltschaft Hannover,
Politische Parteien im Nds. Landtag,
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover,
Bund der Steuerzahler,
Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger,
Richard-Wagner-Vereine,
Feuilletons von Tageszeitungen
RA Frank Wahner, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Hannover
RA Markus von Hohenhau, Fachanwalt für IT-Recht, Regensburg
Wir verstehen diese Besprechungen und
Kommentare nicht als Kritik um der Kritik willen, sondern als Hinweis
auf - nach unserer Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes. Neben
Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und Satire. Hierfür
nehmen wir den Kunstvorbehalt nach Artikel 5, Grundgesetz, in Anspruch.
Wir benutzen Informationen, hauptsächlich aus eigenen Unterlagen, aus
dem Internet u.a. Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Museums,
der Preußen-Chronik, Wikipedia u.ä..
Texte werden paraphrasiert wiedergegeben oder als Zitate kenntlich
gemacht.
Fotos wurden Buch- und CD-Einbänden entnommen.
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir meist
auf Differenzierung und geschlechtsneutrale Formulierung. Entsprechende
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und
beinhaltet keine Wertung.
|
 |
Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:
Als Zeitungs- / Theater-Abonnent und Abnehmer von voll bezahlten
Eintrittskarten aus dem freien Verkauf verstehe ich
diese Besprechungen und Kommentare nicht als
Kritik um der Kritik willen,
sondern als Hinweis auf - nach
meiner Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes.
Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und
Satire.
Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,
Grundgesetz, in Anspruch.
Dieter Hansing
|
|