| |
... am 24. März 1933
veröffentlicht.
Das 'Ermächtigungsgesetz' - diente nicht dazu, die Republik
handlungsfähig zu machen, sondern um sie
abzuschaffen.
Es gilt als rechtliche Hauptgrundlage der
nationalsozialistischen Diktatur. Es schuf den
Nazis die Möglichkeit, nach eigenem Gutdünken zu
handeln.
Da der Reichstag nach dem Reichstagsbrand am 27.
Februar 1933 nicht
benutzt werden konnte, tagte das Parlament in
der 'Krolloper'.
Das Gebäude wurde von der SS
abgesperrt, die an diesem Tag erstmals in
größerem Rahmen in Erscheinung trat. Im Inneren
standen lange SA-Kolonnen. Als weitere Neuerung
hing eine riesige Hakenkreuzfahne hinter dem
Podium.

►
Originalton
Hitler sprach - er
argumentierte, unter äußerem Druck, diese durch
SA-Präsenz dokumentiert - es könne nicht
angehen, dass die Regierung bei jeder Art von
Tun im Rahmen der Bewegung, sich die Zustimmung
des Reichstages 'erbitten' müsse. Daher habe man
sich entschlossen, dieses Gesetz den
Abgeordneten zur Entscheidung vorzulegen.
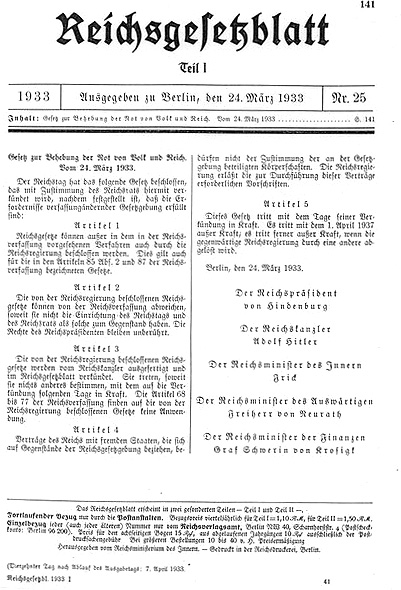
|
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NSDAP),
Deutschnationale Volkspartei (DNVP),
Zentrum,
Bayerischer Volkspartei (BVP),
Deutsche Staatspartei (DStP),
Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVd),
Deutsche Volkspartei DVP),
Bauernpartei,
Landbund
beteiligten sich an der Abstimmung.
Die KPD-Abgeordneten konnten nicht teilnehmen,
da ihre Mandate im Rahmen der
Reichstagsbrandverordnung vom 8. März 1933
annulliert worden waren, wurden jedoch als
anwesend mit zustimmendem Votum registriert
Hitler trat dann nochmals an das Rednerpult und
gab der SPD, die als einzige Partei sich dem
Druck widersetzte und die das Gesetz ablehnte -
'eine Antwort, daß die Fetzen
fliegen' und sprach ihnen das Recht ab, eine
Entscheidung treffen zu dürfen, über Frieden
oder Krieg.
|
Der Führer spricht ganz frei und ist
groß in Form. Das Haus rauscht vor
Beifall. Gelächter, Begeisterung und
Applaus. Es wird ein Erfolg
ohnegleichen.
Goebbels
Tagebücher 24. März 1933
|
Göring gab das Ergebnis
bekannt, 444 Abgeordnete stimmten für das
Gesetz, 97 Abgeordnete, die der SPD,
dagegen.
Hierauf stürmten NSDAP-Abgeordnete nach vorne
und stimmten die Zeilen an:
'Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen
...'
Hitler hatte mit dieser Regelung per Gesetz für
zunächst vier folgende Jahre völlig freie Hand.
Einschneidende Maßnahmen
folgten:
Pressezensur, das Gewerkschaftseigentum wurde
eingezogen, die Gewerkschaftsführer verhaftet,
politische Parteien verboten. Als 'Partei' war
nur noch die NSDAP zugelassen.
Am 31. März 1933 wurde dann das
Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 durch das
Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem
Reich auch auf die Landesregierungen übertragen.
Schon
1914 gab es mit dem Kriegsermächtigungsgesetz
Regierungen die
Möglichkeit, ohne das Parlament
einbezogen zu haben, Gesetze erlassen zu können.
Diese Regelung von 1914 bedeutete den 'Durchbruch eines
neuen verfassungspolitischen Prinzips von
außerordentlicher Tragweite' für die Weimarer Zeit ab
1919.
Es handelte sich um ein verfassungsbrechendes
Gesetz, das der Verfassung widersprach, aber in Kauf
genommen wurde, weil es unter den Umständen zustande
kam, die auch für eine Verfassungsänderung nötig gewesen
wären.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von
1949 macht Ermächtigungsgesetze unmöglich.
|
 |
http://www.dradio.de/
"Der physische
Druck auf die Abgeordneten war erheblich"
22.03.2013 · 08:10 Uhr
Historiker
erklärt die Zustimmung zu Hitlers
Ermächtigungsgesetz vor 80 Jahren
Andreas Wirsching im Gespräch mit Christoph Heinemann
Am 24. März 1933 stimmte der
Reichstag dem Ermächtigungsgesetz zu, das
der NS-Regierung erlaubte, ohne Zustimmung
des Reichstags Gesetze zu erlassen. Bei
diesem Ja zur rechtlichen Grundlage der
Hitlerdiktatur spielte auch die Angst der
Abgeordneten vor der anwesenden SA eine
Rolle, erklärt der Direktor des Instituts
für Zeitgeschichte in München, Andreas
Wirsching.
http://www.dradio.de/
|
|
 |
Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:
Als Zeitungs- / Theater-Abonnent und Abnehmer von voll bezahlten
Eintrittskarten aus dem freien Verkauf verstehe ich
diese Besprechungen und Kommentare nicht als
Kritik um der Kritik willen,
sondern als Hinweis auf - nach
meiner Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes.
Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und
Satire.
Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,
Grundgesetz, in Anspruch.
Dieter Hansing
|
|