|
|
Thema des Tages
Uraufführung 'The Beggar's Opera'
... am
29.
Januar 1728
John Gay - er stammte aus einer spanischen Familie - lebte als
Schriftsteller in London und verfasste das satirische 'Spiel um Bettler'
auf einer Bühne. Johann Christoph Pepusch komponierte eine leicht
eingängige Musik dazu.
Der Erfolg war groß, jahrzehntelang stand das Werk im Original auf den
Spielplänen der Londoner Bühnen.
Den 'Unteren' im Staat war es eine Freude, die Kritik an den 'Oberen' in
England so deutlich. Selbst deren Vorliebe für die italienische Oper
wurde parodiert und deren Musik durch Volkslieder und populäre Songs
ersetzt.
Es folgten im Laufe der Jahre Bearbeitungen - eine von ihnen stammt von
Benjamin Britten - weitere von Václav Havel und Richard Bonynge.
Elisabeth Hauptmann, eine der vielen Frauen die Brecht neben
| |
Paula Banholzer, mit der er Kind hat, seinen ersten
Sohn Frank Banholzer - |
| |
|
| |
mit Marianne Zoff,
einer österreichischen Opernsängerin mit der er eine Tochter, Hanne
Marianne hatte, die unter dem Künstlernamen Hanne Hiob die die Johanna in der Gründgens-Schlachthöfe-Inszenierung spielte. |
| |
|
| |
mit Helene Weigel, mit der er den Sohn Stefan und
die Tochter Barbara
hat. |
lernt ihn 1924 in Berlin kennen. Sehr schnell ergaben sich die
verschiedensten Interessenüberschneidungen, so dass privates mit
'geschäftlichem' leicht zu verbinden war.
Die Hauptmann arbeite mit ihm an 'Mann ist Mann', an der 'Heiligen Johanna der
Schlachthöfe - und an der Geschichte der Bettler-Oper, nicht Oper, in
denen Bettler vorkommen, sondern eine Balladen-Oper für Bettler des John Gay.
Sie übersetzt den Text für Brecht, mit dieser Arbeit und mit der
'Dreigroschenoper' von Brecht und Weil trat am 31. August 1928 das
Original 'The Beggar's Opera' in den Hintergrund.
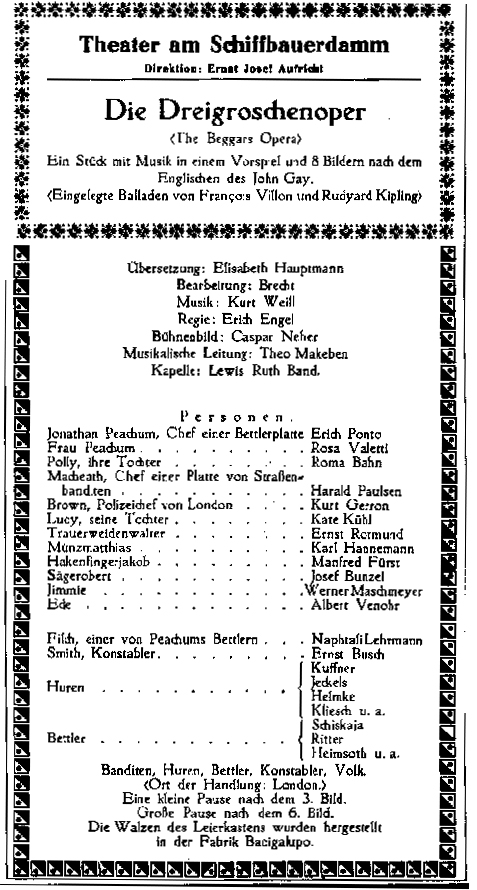
Besetzungszettel
der Uraufführung am Schiffbauerdamm in Berlin
Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:
Als Zeitungs- / Theater-Abonnent und Abnehmer von voll bezahlten
Eintrittskarten aus dem freien Verkauf verstehe ich
diese Besprechungen und Kommentare nicht als
Kritik
um der Kritik willen,
sondern als Hinweis auf - nach
meiner Auffassung -
Geglücktes oder Misslungenes.
Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und
Satire.
Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,
Grundgesetz, in Anspruch.
Dieter Hansing
|
|